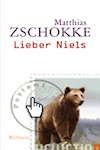Lieber Niels ist ein monologischer Tagebuchroman und das Kondensat aus dem siebenjährigen Emailverkehr zwischen Matthias Zschokke und Niels Höpfner. Auf der »Flucht vor dem totalen Verstummen« schreibt Zschokke dem Gegenüber von seinen alltäglichen Nöten. Ein lesenswerter Brocken aus Melancholie, Zweifel, Angst und Elend.
Von Niels Penke
»Lieber Niels« – diese Anrede klingt vertraut. Ungewöhnlich, dass sich ein Buch so unvermittelt an mich als Leser wendet und ein Autor Tag für Tag in familiärer Aufgeschlossenheit von seinen Nöten, Sorgen und Befindlichkeiten berichtet. Doch diese Wirkung hat Methode und der eigentliche Empfänger Niels ist ein anderer. Denn Lieber Niels ist das Kondensat aus sieben Jahren regen Emailverkehrs zwischen Matthias Zschokke und Niels Höpfner, der diese siebenhundertsechzigseitenstarke Veröffentlichung angeregt hat – zum monologischen Tagebuchroman verschnitten, der an einen adressiert ist, der ausgeblendet nie direkt zu Wort kommt, und dennoch die Regie geführt hat. Bereits 2003 beschleicht Zschokke der Eindruck, er verwandle sich langsam in das Produkt seines Briefpartners, der auf seiner Homepage seit fünfzehn Jahren alles versammelt, was es von und über den »sanften Rebellen« zu lesen gibt.
Warum aber schreibt einer so oft und so viel, wenn er scheinbar nichts zu sagen zu haben glaubt? Aus panischer Angst, auf der »Flucht vor dem totalen Verstummen« vielleicht, wie er selbst vermutet. Und aus der Einsicht heraus, dass auch all die anderen nicht mehr oder weniger zu sagen haben als er, sondern lediglich überzeugtere und eventuell auch bessere Schauspieler sind.
Ich glaube die wenigsten haben etwas zu sagen. Und das auszuhalten und zuzugeben, dieses Nichts-zu-Sagen-Haben, kommt mir mal wieder als meine Hauptaufgabe zu. Deswegen schreibe ich zur Zeit wie in den NY-Aufzeichnungen oder wie hier in dieser Mail: ertrinkend in der Banalität des Alltags und mich gleichzeitig als Rettungsschwimmer betätigend, der mich, den Ertrinkenden, am Ertrinken hindert mit seiner Rettungsschwimmerbanalität.
Gegen das Gros derjenigen, die sich über diese Banalität zu erheben versuchen, schreibt Zschokke seine täglichen Invektiven – und das sind für ihn vor allem die Protagonisten der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: Judith Hermann, Christian Kracht, Uwe Tellkamp oder Raoul Schrott. Das könnte anstrengend sein, ist es erstaunlicherweise aber nicht. Zschokke ist im Gezeter so charmant wie selbstironisch bescheiden im Neid auf die Erfolgreicheren. Ein »Bernhardisieren« in re, das sich zögernd artikuliert und sich oft wieder relativierend zurücknimmt, ein »Walsern« in modo, das Zschokke, wie auch seine Romanhelden, als entscheidungsunfreudigen Zögerer in der Schwebe hält.
Mit einer »an Hysterie grenzenden Empfindlichkeit« beschreibt Zschokke dem Gegenüber seine alltäglichen Erfahrungen und Probleme als nur bedingt erfolgreicher, existenziell gefährdeter und verunsicherter Schriftsteller. Finanzielle Sorgen, Wohnungsnot, das allgegenwärtige Elend im Wedding, in den Zschokke tagtäglich zum Schreiben fährt – Zschokkes Umgebung ist eine Welt, die den Menschen vollends zur »Hölle« gemacht worden ist, aus der es keine Auswege, aber immerhin Ausbrüche gibt: New York, Amman, Marseille, Teheran, nur einige Stationen des guten, wilden Lebens außerhalb.
Dabei ist Zschokke keineswegs der Kannitverstan, als der er im Klappentext basierend auf einer 20 Jahre alten Feststellung des Spiegel charakterisiert wird. Er ist nirgends der tumbe Handwerksbursche mit Verständigungsschwierigkeiten, sondern weiß nur allzu gut, wer und was er ist, wie der Kulturbetrieb funktioniert und welche Rolle er darin spielt. Zu seinem Leidwesen ist es nicht nur eine Nebendraußensteherposition im literarischen Feld, auch in den Industriezweigen Theater und Film besetzt er keine allzu beglückende Stellung. Doch dies, das weiß er wohl selbst am allerbesten, scheint paradoxerweise sein Glück zu sein. So zu schreiben, könnte sich ein Autor unter Bestsellererwartungsdruck nicht leisten; sofern einer je zum Bestseller werden sollte, der das klassische Erzählen so gekonnt vermeidet und sich mit unterminierenden »schiefen« Sätzen digressiv um verschrobene Figuren herumbewegt wie Zschokke.
Dass er diese Dilemmata ausgehalten und den hohen Preis der Selbstaufgabe nie zu zahlen versucht hat, dafür darf die Leserschaft dankbar sein. Auch wenn er »endlich von der Narrenrolle wegkommen« wolle. Ein nur allzu »zeitgemäßer Herr« ist Zschokke, der zwischen Hoffnung und fortgesetzten Deprivationen hin und her geworfen wird, der über die Welt und ihre Systeme leise schimpft und offen leidet, als guter Beweis dafür, »dass irgendwas nicht stimmt«. Es ist eben nicht in Ordnung, sich »täglich von morgens bis abends in die Grube [zu] wünschen wie Hamlet.«
Lieber Niels ist ein schwer zu bewältigender und ebenso schwer verdaulicher Brocken Melancholie, Zweifel, Angst und Elend. Eine Kombination, die ganz sicher kaum zu ertragen wäre, wenn sie nicht durch einen Jean Paulschen Witz abgefedert würde. Überhaupt Jean Paul: »Humor ist überwundenes Leiden an der Welt.« Das wird selten so plastisch wie in den gelungenen Romanen und Erzählungen Zschokkes; bei Max, Maurice, und auch dem nicht nur alliterierend verwandten Ich dieses Buches. »Lachend, soweit es geht.« Was darauf folgt, ist hoffentlich mehr als nur Schweigen. Davon hat Matthias Zschokke schon genug geerntet.


Matthias Zschokke kommt übrigens zur Lesung demnächst nach Göttingen: am 22.11.2011 um 19:30 in das World Coffee am Bahnhof!