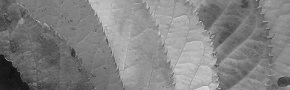Wie sollte eine Sprache wissenschaftlicher Vermittlung aussehen? Innerhalb der Wissenschaftsreihe und der Science & Arts-Reihe des Göttinger Literaturherbstes sind exemplarisch zwei entgegengesetzte Formen einer solchen Vermittlung zum Ausdruck gekommen. Ein kritischer Bericht.
Von Björn Höller
Unter dem Motto Wissenschaft beim Göttinger Literaturherbst sind wie gewohnt einige renommierte Wissenschaftler*innen zu Gegend, um mal ganz menschennah und allgemein verständlich von den sonst schier undurchschaubaren Fortschritten innerhalb nationaler und internationaler Forscherfronten zu berichten. Hier werden in klarer Sprache und nüchterner Manier die harten Fakten präsentiert. Die kryptische Expertise wird übersetzt, entwirrt und bekommt das Gewand der Normal- oder Alltagssprache verpasst, um sich begriffsklar und metaphernlos einen Weg ins Laienohr zu bahnen. Wer sich als Experte besonders geschickt in diesem Übersetzungsvorgang erweist, hat sich zugleich traditionellerweise im Rahmen des Literaturherbstes die sogenannte Science Communication-Medaille verdient: zur Ehrung eines besonders gelungenen Transfers wissenschaftlicher Inhalte in die Öffentlichkeit.
Reihe

Vom 12.-21. Oktober fand der 27. Göttinger Literaturherbst statt. Als Nachklapp veröffentlicht Litlog in der Woche vom 22.-28. Oktober jeden Tag einen Bericht zu den diversen Veranstaltungen des Programms.
Hier findet ihr die Berichte im Überblick.
Medaille
Die Wissenschaftsreihe des Literaturherbstes wird in Kooperation mit den Göttinger Max-Plank-Instituten und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek veranstaltet. Seit 2014 wird in diesem Rahmen auch die Science Communication-Medaille verliehen. Dieses Jahr erhielt Mike Miodownik die Auszeichnung für die Vermittlung seiner Materialforschung.
Die Reihe Science & Arts wird in Kooperation mit der Georg-August-Universität Göttingen veranstaltet. Ihr Ziel ist es, verschiedene Disziplinen im Bereich Wissenschaft und Kunst in den Blick zu nehmen.
Wissenschaft in der Paulinerkirche
Ein im Rahmen dieses Vorhabens gehaltener Vortrag der Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen über Künstliche Intelligenz (kurz KI) zeigte einerseits das fruchtbare Element eines solch lobenswerten Unterfangens, andererseits aber auch dessen Tücken. Lenzens Präsentation gliedert sich in die oben genannte Wissenschaftsreihe des Literaturherbstes ein, in der die besagte Medaille verliehen wird. In der Paulinerkirche in Göttingen, wo einstmals lutherische Gottesdienste abgehalten wurden (jetzt Teil des Bibliotheksverbands der Universität), kamen am Sonntagabend, dem 14. Oktober, interessierte Menschen, vor allem höheren Alters, zusammen, um Lenzens Ausführungen zu lauschen:
Aus den Stuhlreihen tritt erwartungsvolles Gemurmel hervor, während die hohen Decken des einstigen Dominikanerklosters jedes Rascheln und Stühlerücken hallend in die Weite des Raums werfen. Die pastorale Stimmung des Gebäudes durch die Gipsabgüsse grimmig dreinschauender Wissenschaftler und die hinter Vitrinen verschlossenen antiquarischen Buchbestände geradezu säkularisiert. Was innerhalb dieser kahlen Wände stattfindet, wer auch immer hervortreten und sprechen würde, die Blicke der Zuhörenden sind unweigerlich auf das noch unbesetzte Rednerpult in der Front des länglichen Raums ausgerichtet. Andächtiges Abwarten, bis die angekündigte Frau Lenzen unter gedimmten Licht den Saal betritt. Hier ist Großes zu erwarten und jedes Wort wird den Beiklang jahrhundertealter Klostersteine mit sich tragen. Der Abend ist ausverkauft.
Philosophie im Auditorium
Ungefähr zur selben Zeit in Göttingen am Tag davor: Einige Reihen bleiben zwar spärlich besetzt, jedoch ist der Hörsaal des alten Auditoriums als Ganzes angenehm gefüllt. Der Göttinger Professor für Praktische Philosophie Holmer Steinfath und der italienische Philosoph Emanuele Coccia unterhalten sich bereits, von Strahlern beleuchtet, auf einer kleinen Anhöhe in der Front des Raumes, während die Zuhörer*innenschaft sich niederlässt. Es herrscht eine heimelige Atmosphäre. Als ob etwas noch Unartikuliertes den Raum beschweren würde, stimmt die schummrig-trübe Lichtsituation und die von Pflanzen gezierte Bühne bereits auf einen rätselvollen Vortrag ein. Die lebhaft diskutierenden Philosophen im Scheinwerferlicht verleihen dem Ganzen, umrahmt vom Grün, beinahe etwas Mystisches.
 Emanuele Coccia und Holmer Steinfath ©Höller.
Emanuele Coccia und Holmer Steinfath ©Höller. Nicht weit entfernt, zumindest im selben Gebäude, befindet sich die umfangreiche Kunstsammlung der Universität Göttingen. Auch hier, im Lesesaal, wird schnell klar, dass sich Wissenschaft und Kunst vermischen würden, wenn Coccia aus seinem kürzlich im Hanser Verlag erschienenen Buch Die Wurzeln der Welt mit dem Untertitel Eine Philosophie der Pflanzen lesen und mit Steinfath darüber reden würde. Lesung und Gespräch finden innerhalb der Reihe Science & Arts statt.
Lenzen erdet die Mythen um Künstliche Intelligenz
Zurück zur Paulinerkirche. Manuela Lenzen spricht klar und deutlich, einwandfrei, ohne Aussetzer und ohne auszuschweifen. Ihr Anliegen ist es, die KI-Forschung von ihrem illusorischen Beiwerk, von all der Panikmache und Zukunftsangst, aber auch von mystifizierten Utopien zu bereinigen. Viele hätten in der Vergangenheit das Thema durch eine »Brille der Fehleinschätzung« betrachtet, weil sie befürchteten, auf dem Feld der KI-Forschung die Kontrolle verlieren zu können. Zudem habe man die komplexen Maschinen mit künstlicher Haut und montierten Gesichtern zumeist unbedacht und vorschnell vermenschlicht.
Durch Nüchternheit und Objektivität befreit sie die KI von ihrer effekthascherischen medialen Zirkulation und erdet mit wissenschaftlich-kühner Selbstsicherheit, was in 90 Minuten Vortrag zu erden ist. Das gelingt ihr, auch wenn dahinter eine tiefere Besprechung des Themas zurückbleibt. Die Geschichte von immer komplexer werdenden Maschinen, Deep Learning und Neuronalen Netzen, Blackbox, Transferlernen und anderen hybriden Lernverfahren werden umrissen.
Bei alledem wird deutlich: Das hat noch nicht viel mit dem zu tun, was wir an uns Menschen mit dem Wort ›Intelligenz‹ bezeichnen. Hinter der menschenähnlichen Fassade schlummern eben doch rechnende Maschinen,
Buch 1

Manuela Lenzen
Künstliche Intelligenz. Was sie kann & was uns erwartet.
C.H.Beck: München 2018
272 Seiten 16,95€
Buch 2

Emanuele Coccia, übersetzt von Elisabeth Ranke
Die Wurzeln der Welt. Eine Philosophie der Pflanzen.
Carl Hanser Verlag: München 2018
192 Seiten 20,00€
Noch weiter entfernt scheint die KI von Dingen wie Bewusstsein oder Moral, die an sich schon schwer zu verstehen und momentan noch zu unaufgeklärt seien. Gegen Ende ihres Vortrags ermuntert Lenzen zur Mitgestaltung der Gesellschaft. Sie gibt die »Hausaufgabe« auf, rationale Utopien (als Gedankenexperiment) in einer Welt mit zunächst nebulös scheinenden künstlichen Intelligenzen zu denken. Davor, dass die Maschinen bald zu Menschen werden würden, sei zu entwarnen. Denn menschlich sei mitunter »mangelnde Genauigkeit«, die der Algorithmus vermissen lässt. Lenzen paraphrasiert die Mathematikerin Cathy O’Neil und beendet ihren Vortrag: »Wenn die Welt perfekt wäre, könnten wir sie den Algorithmen überlassen.«
Coccia bringt das Mysterium der Pflanzen zur Sprache
Am Tag zuvor im Auditorium liest und erklärt Coccia auf Deutsch (seine Muttersprache ist Italienisch). Er sucht nach Worten und Gedanken, nach einer passenden Artikulation, um seine Ideen mitzuteilen, nennt Beispiele und benutzt zahlreiche Metaphern. Die vorgelesenen Passagen aus seinem Buch muten poetisch bis kryptisch an. Es ist schwer den Gedanken im Detail zu folgen und doch mischt sich das unerklärliche Gefühl unter, auf irgendeine Weise zu verstehen, wovon die Rede ist. Pflanzen seien nicht nur der Garten, sondern sie seien »Gärtner und Garten in einem«. Sie seien die einzige lebendige Lücke in einem autoreferenziellen System, das in einer »unermesslichen kosmischen Tautologie« bestehe, dass Leben im Wesentlichen »ein Leben vom Leben der anderen« sei. Das zeige sich in der Atmung und der Nahrungszufuhr der Menschen.
Coccia zeigt anhand des Blattes, der Wurzel und der Blüten wie grundständig sich die Pflanze von der Welt durchqueren lasse und in die Welt eintauche, oder wie sie sich beim Sex gewissermaßen selbst modifiziere, neu formuliere. Wie unser Atmen, das Leben in seiner ersten Bedingung, von der Photosynthese, also der Öffnung der Pflanze hin zur Welt abhänge. Und zuletzt, dass alles in der Welt sich miteinander mische und Mischungen hervorbringe.
Ähnlich wie Manuela Lenzen mit der KI versucht Coccia die Pflanzen vor einem unüberlegten Anthropomorphismus zu bewahren, aber nicht indem er die harten Fakten der Wissenschaft zur Sprache bringt, sondern die Begriffe gerade poetisch-metaphorisch zu Mischungen arrangiert, wie die Welt es mit den Dingen tut.
Eine perfekte Wissenschaft für eine perfekte Welt
Lenzen spricht von Maschinen und bedient sich der Sprache der Eindeutigkeit, Coccia von Pflanzen und er bedient sich dabei der Sprache der Mehrdeutigkeit. Zuletzt will man meinen, Erstere wird dabei zur Maschine durch eine maschinelle Wissenschaft, während Letzterer sich zur Pflanzenwelt hin verflüchtigt mit seinen Gedanken der Mischung. Jedenfalls ist es tückisch, dass die Sprache der Wissenschaft noch als die Sprache der unumstößlichen Wahrheit auftritt, mit einer quasiheiligen Aura versehen innerhalb der sakralen Wände der Paulinerkirche und sich zugleich mit Nüchternheit und Objektivität schmückt; während der sich öffnenden, mitunter expressiven Sprache weiterhin etwas Anrüchiges anhaftet und sie in den Bereich der Kunst verbannt wird.
Wenn es Algorithmen sind, die Perfektes erzeugen, dann steht die Vermutung im Raum, dass sie zwar nicht die besseren Menschen wären, vielleicht aber die besseren Wissenschaftler*innen. Jedenfalls gäbe es keinen Zweifel an der Eindeutigkeit ihres Verfahrens. Aber möglicherweise sollte sich die Wissenschaft (zumindest die Geisteswissenschaft) ihre Menschlichkeit bewahren, also ihre Uneindeutigkeit. So wäre es nur fair, wenn sich »Kommunikation« in der Science Communication-Medaille auch auf all die eigentümlichen Sprachstile beziehen würde, die sich sonst als das Abseitige ausgeklammert sähen, zumal deren Anti-Perfektionismus ein entscheidendes Differenzkriterium zur künstlichen Intelligenz bildet.
Um mit einer Formulierung aus Coccias Buch zu schließen:
Die Spezialisierung definiert keinen Wissensexzess, sondern einen bewussten, absichtlichen Verzicht auf das Wissen der ›anderen‹. Sie ist nicht Ausdruck einer übermäßigen Neugierde für einen Gegenstand, sondern skrupulöser Respekt eines kognitiven Tabus.