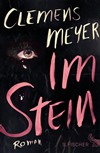Clemens Meyers Roman Im Stein verhandelt unvermittelt die brüchigen Randzonen der Gesellschaft. Über düstere Milieus, die Rolle als enfant terrible des Kulturbetriebs und die dennoch sensiblen Seiten des Autors berichtet Malte Gerloff, der die Lesung im Literarischen Zentrum besuchte.
Von Malte Gerloff
Eine etwas zu spät gekommene Gruppe Studenten sucht noch Plätze, Clemens Meyer und sein Moderator betreten die Bühne, Gesa Husemann hält die Anfangsansprache. Sich drehend und wendend, um den räumlichen Gegebenheiten des Zentrums gerecht zu werden – rechts wie links vollbestuhlt. Ausverkauft ohne Ausverkauf ist das heutige Programm im Sumpf des Zwielichts, getaucht in weißes Neonlicht präsentiert sich dieses auf der Bühne im schwarzen Anzug und weißen T-Shirt. Mit wesentlich höherer Präzision als das Licht die Bühne ausleuchten könnte. Den einleitenden Worten folgt die Anmoderation von Kolja Mensing, einem der Anzüge in schwarz und weiß. Bekanntes wird taxiert und vorgestellt: Die Werke des Autors, die Biographie des Autors, die Vorbilder des Autors und so wird schon explizit genannt, was auch kaum zu überdecken sein wird, was fast einer Metempsychose gleichkommt und in seiner Genauigkeit beinahe angsteinflößend wirken wird; wenn man das Vorbild kennt, wenn man den Lesungssound Jörg Fausers kennt, oder die Vertonung dieser Lesungen, die Fausertracks, von lebendigital. Kennt man diese, kennt man den Sound, den Clemens Meyer nun anbringen wird: knurrig, nuschelnd, sonore Stimme. Der sächsische Dialekt Meyers ist beim Lesen auf verwundernswerte Weise kaum vom hessischen Dialekt Fausers zu unterscheiden. Auch die Themenkreise von Clemens Meyer und denjenigen, die dieser – wie er später freigiebig zugeben wird – verehrt – also: Fauser, Fichte, Hilbig – seltsamerweise bleibt Brinkmann ungenannt – gleichen sich aufs Haar: Huren, Halbwelt, Ganoven, Kleinkriminelle. Die Zonen, in denen unsere Welt brüchig ist, fernab des gesetzten Bürgertums mit seinen wohlig ausgeschlagenen Salons und Bücherregalen. Hier geht es ums Sitzen und Warten – auf den nächsten Freier.
Ziegelstein-PoetikDoch sind auch die Parallelen auf der Metaebene gleichsam frappierend: zum einen das Spiel mit dem Genre des Kriminalromans und zum anderen? Dass diese Halbwelt natürlich nur als Plattform für die großen Fragen von Raum und Zeit dient, die innerhalb von Meyers Roman Im Stein stets aufs Neue ineinander fließen, sich überschneiden und verschränken – Vergangenes ist so immer auch Teil des Gegenwärtigen – und die große Frage des Lebens, wie, wann und wo wertes Leben ist, ja sein kann, gestellt wird. Fragen, die das Gespräch prägen, welches den größten Teil der Lesung einnimmt und in dem die literarische Prägung des Autors immer wieder umkreist und zentriert wird, die von Märchen über Stevensons Schatzinsel über Chandlers Hard-Boiled-Prosa bis hin zu den deutschsprachigen Beatniks reicht. Aus denen die Poetologie extrahiert und dann daraus der Ziegelstein geformt wurde, den Clemens Meyer in die frisch polierte Fassade der Literatur geworfen habe – so Kolja Mensing.
Um dann wieder zur Poetik zurückzuspringen und festzustellen, dass es ein poetologisches Fortschreiben ist, wie es auch Franz Dobler betreibt, was Meyer allerdings verschweigt und stattdessen sagt: Es gebe keine Postmoderne – das sei doch alles Quatsch – sondern die Moderne schreibe sich immer weiter fort. In diesem Fall schreibt sie sich fort in den brüchigen Randzonen, mit dem Geruch von geronnenem Sperma, auf einer fleckigen Bettdecke in einem Wohnblock voller Traurigkeit – erhellt lediglich durch die Leuchtreklamen und nicht von der Hoffnung. Augenfällig sind auch die ähnlichen Mittel des Stils, die er wählt: Popzitate, Schnitte, Brüche. Popmusik ist bei ihm genauso essentiell wie bei Fauser, der ja sogar Popsongs für Achim Reichel schrieb – hier als Trio-Zitate bei den Kapitelüberschriften oder auch immer wieder tief im Bewusstseinsstrom der Huren vorhanden.
Eden-City ins Fragment geschlagenSo bilden also die Trio-Zitate den Eingang zu diesem Panoptikum im Glassplitterberg. Und in seinem Roman präsentiert sich eine Stadt, wohl teils scherzhaft Eden City genannt, die höchstwahrscheinlich ein zusammengewachsenes Hybrid aus Leipzig und Halle darstellt, und in dem eine Panorama-Optik ins Fragment geschlagen wird wie brüchiges Glas. Oder wie Facettenaugen einer Fliege, die in die Köpfe fliegen kann und die Gedanken zu lesen vermag, um dann wieder herauszufliegen. Alles wieder auf Vollbild. Rausgezoomt. Dann wieder reingezoomt. In einen anderen Stadtteil. In ein anderes Leben. Dann wieder in den Kopf gezoomt. Gedankenstränge und –wülste. Und immer mehr Dreck und Trauer aus der Perspektive der Figur mit ihrem vollen Bewusstseinsstrom. Das heißt im Klartext hier: Noch mehr Dreck. Noch dunklere Seiten dieser namenlosen Stadt in Ostdeutschland werden offenbar. Es sind Seiten des Lebens, in denen man nicht mehr von Ausleuchten sprechen kann und sollte, so finster ist das, was man nur mit einem Schlucken und einem gesenkten Kopf nun schreiben muss – weil es eben da war. Es ist eine Offenlegung der dunkelsten Seiten des schon oder wohl eher immer noch verrufenen Gewerbes. Clemens Meyer kämpft sichtbar mit sich selbst und liest sie doch: die Teile des Romans aus der Sicht der Kinderhuren. Die schlimmeren Stellen spart er aus. Dennoch ist es verwunderlich, dass – es mag an dem mit sich ringenden Autor, der von den Schwierigkeiten beim Schreiben berichtet, liegen – es keinen Aufruhr, keine Skandalrufe im Publikum gegeben hat, als diese Stelle verlesen wurde. Sondern nur eine Stimmung, die von Betretenheit geschwängert zäh dahinfloss, im Wissen, dass »[d]ie Dinge sind, wie die Dinge eben nunmal so sind«, wie es auch schon Huren-Babsi in Im Stein einleitend feststellen muss, was aber nicht Teil der Lesung war. Die danach ein abruptes Ende fand.