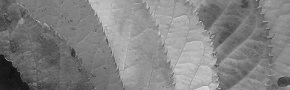Anne Weber, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020, macht auf ihrer Lesung beim Literaturherbst deutlich, dass sie ein Epos und keinen Roman geschrieben hat, um die Illusion von Realitätsnähe zu vermeiden. Dem Deutschen Buchpreis und allen anderen ist das leider egal.
Von Frederik Eicks
Normalerweise gibt es mehr Trara um den:die deutsche Buchpreisträger:in: Pressetermine, allerlei Veranstaltungen, zu denen geladen wird, und und und. Dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Anne Weber habe ihre erste Woche als Gewinnerin ganz entspannt zu Hause verbracht, sagt sie zu Beginn ihrer Lesung am 17. Oktober 2020 beim Göttinger Literaturherbst, der trotz widriger Umstände zum mittlerweile siebten Mal in Folge die erste Lesung des:der Preisträger:in außerhalb der Frankfurter Buchmesse veranstalten darf. Die Entscheidung der Jury für ihr Buch Annette, ein Heldinnenepos habe sie selbst überrascht, denn für sie sei ein wesentliches Merkmal vorangegangener Gewinnertitel deren Massentauglichkeit. Damit grenzt sich Weber gleich zu Beginn der Lesung von anderen Preisträger*innen ab. Ähnlich verfährt auch Moderator Stephan Lohr: Der Unterschied zu anderen Texten ist ein zentrales Thema an diesem Abend, wobei sich das Gespräch gegen Ende leider immer weiter vom Buch weg bewegt und sich stattdessen um das Leben der real existierenden Protagonistin Anne Beaumanoir dreht.
Dabei ließe sich so viel mehr über den Text selbst sagen, dessen Form tatsächlich ungewöhnlich ist – wie schon der Titel verrät. Denn es handelt sich bei Annette, ein Heldinnenepos nicht um einen Roman, nicht einmal um einen klassischen Prosatext, sondern um ein Versepos. Zeile für Zeile schreibt Weber vom Leben der französischen Résistance-Kämpferin, von ihrem Engagement im kommunistischen Untergrund des besetzten Paris im Zweiten Weltkrieg und von ihrer Unterstützung der algerischen Befreiungsbewegung ›Front de Libération Nationale‹, für die sie zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Wie wenig der Text für ein breites Publikum angelegt ist, stellt Weber beim Vorlesen unter Beweis: Egal, ob der Satz abschließt oder nicht, am Versende macht sie eine Pause. Pausen, die länger sind als zwischen übrigen Wörtern, aber kürzer als nach einem Punkt. Sie erschweren es, sich in dem Text zu verlieren und versperren Hörenden den freien Zugang. Für diesen Text muss man arbeiten.
Gegen die IllusionLohr erläutert dem Publikum das Zustandekommen der Pausen: »Das ist dem offenen, freien Gebrauch des Verscharakters geschuldet.« Bemerkenswert ist an diesem Satz zweierlei. Zum einen die Bedienung aus dem Wortfeld der Schuld, als handele es sich um eine Lästigkeit, mit der man sich nun einmal abplagen müsse; zum anderen die Prämisse, dass beim Lesen von versifizierten Texten automatisch Pausen am Versende gelesen würden. Doch das ist bei Lesungen klassischer Lyrik häufig nicht der Fall. Weber hält also beim Lesen ihres Versepos eigentlich nichts davon ab, über das Versende hinwegzulesen, es in der gesprochenen Sprache nicht zu markieren. Ihre Entscheidung, es dennoch zu tun, ist keine eigenbrödlerische Macke – immer diese Künstler:innen! –, sondern Weber betont damit den formalen Aspekt ihres Texts, der für sie schriftstellerisch wie persönlich eine immense Rolle spielt.
Weber kennt die inzwischen 98-jährige Anne Beaumanoir, mehr noch, ist mit ihr befreundet. Zu Beginn des Schreibprozesses habe sie sich entsprechend gefragt, inwieweit sie sich dem wirklichen Leben und der Geschichte dieser Frau für ihre literarischen Zwecke bedienen dürfe. Eine Biografie habe sie nicht schreiben wollen. Einen Roman zu schreiben hätte geheißen, Figuren Worte in den Mund legen zu müssen, die sie nicht gesagt haben. So sei sie schließlich zur Form des Versepos gekommen, die Distanz zur Protagonistin schaffe und allem eine Künstlichkeit verleihe, die eine mögliche Romanillusion umgehe: »Es ist mein Blick auf sie, nicht sie selbst.« Wenn bei ihrem Vorlesen also ein eher holpriger Rhythmus aus den Sätzen ruckelt, dann liegt die Ursache nicht im Verscharakter selbst. Sie liegt in der Betonung des Verscharakters, darin, dass die Versform alles andere als egal ist.
 Buchpreisträgerin Anne Weber © Dietrich Kühne
Buchpreisträgerin Anne Weber © Dietrich Kühne Vor dem Hintergrund, mit welchem Nachdruck Weber auf die Künstlichkeit ihres Texts hinweist und sich gegen die Gattungsbezeichnung ›Roman‹ sperrt, muten die Bewerbungstexte zu ihrer Lesung und ihrem Buch außerordentlich seltsam an: Im Programm des Göttinger Literaturherbsts heißt es über den Deutschen Buchpreis, jedes Jahr werde der »beste Roman in deutscher Sprache« ausgezeichnet. Das steht ziemlich genau so auch bei Wikipedia und ließe sich wohl damit entschuldigen, dass es sich hierbei um einen vom Deutschen Buchpreis übernommenen Wortlaut handelt. Auf fast alle bisherigen Gewinnertitel trifft diese Beschreibung sicherlich zu, wobei schon Bodo Kirchhoffs Widerfahrnis und Saša Stanišićs Herkunft auf eine eigenständige Gattungszuschreibung im Untertitel verzichten und auch die Verlagstexte das Wort ›Roman‹ tunlichst vermeiden.
Gegen die Buchpreis-Jury
Reihe

Vom 17. Oktober bis 1. November 2020 fand der 29. Göttinger Literaturherbst statt. Litlog veröffentlicht ab jetzt jeden Werktag einen Bericht zu den diversen Veranstaltungen des Programms.
Hier findet ihr die Berichte im Überblick. Bis zum 30. November könnt ihr die Lesungen außerdem in der Mediathek des Literaturherbsts ansehen.
Absurd wird diese Textsortenblindheit, wenn man dieser Tage die Website des Deutschen Buchpreises besucht, über deren Startseite sich in voller Breite ein unübersehbares, herbstgrünes Banner mit der Aufschrift ›ROMAN DES JAHRES 2020‹ zieht. All das Lob, das die Jury für diesen Text übrighat, reicht anscheinend nicht aus, um ihn in seiner tatsächlichen Form zu würdigen. So spricht zwar der Begründungstext anfänglich von der Form des Epos, vollzieht dann aber in kürzester Zeit – im selben Satz nämlich – die Abkehr von diesem hoch interessanten Formaspekt und schwafelt von der Lebensgeschichte der Protagonistin, die Weber »zu einem Roman […] verdichtet« habe. Im Endeffekt ließe sich alles, was der Jury zu Annette, ein Heldinnenepos einfällt, genauso über einen Roman desselben Inhalts sagen.
Natürlich handelt es sich bei Beaumanoirs Leben um eine spannende, erzählenswerte Geschichte. Dabei die Form völlig auszuklammern, ihr sogar zu widersprechen, ist ignorant gegenüber dem Text und respektlos gegenüber der Autorin, die sich an diesem Abend beim Literaturherbst zwar nie explizit kritisch dem Buchpreis gegenüber äußert, sich dennoch sichtbar gegen allerlei Zuschreibungen wehrt, wie sie auch vonseiten des Buchpreises kommen. Statt den Text für das auszuzeichnen, was ihn besonders macht und von anderen Titeln auf der Shortlist unterscheidet, wird er für das gelobt, was ihn gleich macht – schade. So viel zur Massentauglichkeit des Deutschen Buchpreises.