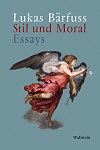Am 18. und 19. Januar 2017 wird der Dramatiker, Romancier und Essayist Lukas Bärfuss die Göttinger Lichtenberg-Poetikvorlesung halten. Ob das ein Grund zur Vorfreude ist, verrät der Blick auf sein bisheriges Schaffen und in die jüngste Publikation, die Essaysammlung Stil und Moral.
Von Stefan Walfort
Lukas Bärfuss schabt gerne an der Tünche, mit der Menschen sich selbst und anderen weismachen wollen, dass alles in bester Ordnung sei, und zum Vorschein kommt die gesamte Bandbreite der Schwäche und Perfidie: Da ist der Busfahrer, der schlicht deshalb, weil er es kann, einer blinden Passagierin damit droht, sie zu ermorden und im Wald zu verscharren (Der Bus). Weil er glaubt, niemand werde ihm die Tour vermasseln, fürchtet er keine Konsequenzen. Da ist die Frau, die an den Macken ihrer geistig behinderten Tochter zu verzweifeln droht, ihr letztlich die Gebärmutter entfernen lässt und ihr trotz aller Irreversibilität des Vorgangs vorgaukelt, sie bekomme sie eines Tages wieder eingesetzt. Anders weiß sie sich nicht zu helfen, nachdem sich das Kind von einem kauzigen Kerl hat schwängern lassen und weil es obendrein, nach einer Abtreibung, sofort wieder neuen Nachwuchs zeugen will (Die sexuellen Neurosen unserer Eltern). Da ist der Typ, dem in einer Talkshow der Kragen platzt, weil ihn empathielose Absahner dazu nötigen, vor laufenden Kameras mit einem Werbemaskottchen auf dem Kopf über den Holocaust zu plaudern (Zwanzigtausend Seiten). Da ist der Bericht über den Suizid des Bruders (Koala), für den Bärfuss 2014 den Schweizer Buchpreis einsackte. Und da ist die Geschichte über den Genozid in Ruanda, in der ein sich anfangs noch als »Weltgewissen«1 aufspielendes Bürschchen später knietief durchs Blut watet (Hundert Tage).
Lukas Bärfuss provoziert gerne ‒ nicht nur, wenn er seine Figuren, mehr noch, wenn er seine Heimat ‒ die Schweiz ‒ entlarvt: In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung malte er letztes Jahr unter die Überschrift Die Schweiz ist des Wahnsinns das Bild einer Nation am Rand der Psychose. Eine an »Manie« grenzende Großmannssucht habe die Schweizer_innen im Griff. Eine »Umnachtung« sei der Grund, weshalb allerorten die Niedertracht eines »immer frecher« und »immer primitiver« herumtollenden Rechtspopulismus akzeptiert werde. Um die einzigen Kräfte, in deren Think-Tanks progressives Potenzial entfaltet werden könnte, um »[d]ie Linke und die Gewerkschaften«, sei es kaum besser bestellt.2 Nicht nur lobende Worte hat er für diese Kritik kassiert. Seine Antwort jedoch lautete: »Es gibt Sachen, die hätte ich noch deutlicher schreiben können.«3
An Deutlichkeit lässt es Stil und Moral, ein Sammelsurium aus vierundzwanzig teils zuvor schon im Tagespiegel, in der Neuen Zürcher Zeitung, der Welt sowie in diversen Kultur- und Theatermagazinen erschienenen Essays, nicht missen. Diesmal nimmt Bärfuss alle Lesefreudigen ins Visier: Lektüregenuss hält er wegen der »Weltlage« für einen Ausdruck der »Absonderung von den Bedürfnissen [d]er Umwelt«, für eine geradezu den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung erfüllende Idiotie.
Gegen die kuschelige Naivität
Lukas Bärfuss polarisiert: Manche finden, er plustere sich zu arg auf und bleibe, was beanstandete Sachverhalte angeht, »zu wenig schlüssig«.4 Andere wertschätzen es, wie er »die dicken Bretter der Selbstzufriedenheit und Ignoranz, mit denen wir unser Bewusstsein gegen unangenehme Wahrheiten panzern«, mit dem Bohrer bearbeitet.5 Ist Stil und Moral also wieder einmal ein Angriff auf alles und jeden? Eine Litanei über ach so furchtbare Umstände und über das, was ohnehin alle wissen?
In der Tat hat Bärfuss wieder viel zu beanstanden, und manches hat wenig Neuigkeitswert. Ja, er regt sich auf über eine »Welt […], die von jedem den Preis, aber von nichts den Wert« kenne. Ja, er giftet gegen eine Welt, in der den Menschen »mit aller Kraft« ihre Individualität ausgetrieben werde. Ja, ihn wurmt diese Welt, in der der Begriff der Freiheit verkümmere zu einem »religiösen Prinzip, einem Ideal, das durch sich selbst gut ist, nicht durch die Folgen, die wir damit realisieren«. Er will sich nicht abfinden mit einem Politikbetrieb, in dem die Ratlosigkeit dominiere und der deshalb essenzielle Werte, beispielsweise die im digitalen Zeitalter nach wie vor geltenden »Persönlichkeitsrechte«, nicht verteidige. Bärfuss glaubt, er müsse auch diesmal den Rezipient_innen eine rosa Brille von der Nase reißen, beispielsweise indem er wie in dem 2008 erschienenen Roman Hundert Tage erneut in Erinnerung ruft, dass Afrika, anders als es ihm in der Schule eingetrichtert worden sei, noch nie ein »Land der Unschuld«, stattdessen immer schon von »tausend[en] Massaker[n]« heimgesucht gewesen sei. Damit bleibt er aber auf Distanz zu dem Hauptproblem, das weniger ein Erkenntnis- als ein Rückzugsproblem ist.
Zielführender scheint es zu sein, wenn er die Annahme, »dass gewisse Werke unser Bewusstsein verändert haben«, dekonstruiert. Mythen von dieser Sorte sind es nämlich, weswegen sich ein Rückzug in die Kuschelecke der Naivität bislang mühelos rechtfertigen ließ. Manche Intellektuelle haben diesen Rückzug, wenn auch ungewollt, legitimiert: Sie waren verzückt, wenn prominente Sendungsbewusste zu Autoritätstopoi griffen. Schneller noch, als Jean Paul Sartre den Namen Marx aufs Papier tippen konnte, entledigten sie sich ihres kritischen Bewusstseins. In dem Vorwort zu Frantz Fanons antikolonialistischer Streitschrift Die Verdammten dieser Erde ermunterte Sartre dazu, Fanons Buch vor allem deshalb »zu lesen«, weil es »beschämen wird, und weil die Schande, wie Marx gesagt hat, ein revolutionäres Empfinden ist.«6 Der Glaube, es gehe etwas Progressives aus von diesem mehr diffusen als analytisch unterfütterten Empfinden, entpuppt sich heute wie damals als Irrtum. Die Schande weckt Wünsche nach Verdrängung. Sie nährt Apathie. Sie lähmt. Sie treibt Menschen in den Autoritarismus – heute zur AfD, damals zur autoritären Linken. Deshalb spottete Adorno zu recht, Stalin müsse »sich nur räuspern, und sie«, die Intellektuellen, »werfen Kafka und van Gogh auf den Müllhaufen.«7
1961 hofften noch nicht so viele Menschen wie in jüngerer Zeit darauf, in den kapitalistischen Zentren eine bessere Zukunft zu finden. Deshalb mengte sich in die Schande immer auch eine Gewissheit, dass alles so bleiben wird, wie es ist. Gewissheiten wie diese sind mittlerweile erschüttert. Die Schande bringt das Begehren hervor, nicht schuldig zu sein. Es ist die ideale Voraussetzung, um Schuld auf andere zu projizieren, auf vermeintlich versagende Politiker_innen, auf alle, die sich engagieren, auf die flüchtenden Menschen selbst. Daraus resultierende Dilemmata kann Literatur nicht lösen, so lässt sich dem Tenor von Stil und Moral gemäß schlussfolgern. Sie kann auch keine Absolution erteilen. Bärfuss verdeutlicht, wie selbstreferenziell Literatur letztlich ist: »Kunst ruft zur Kunst auf, und wer einen Roman zu Ende gelesen hat, fragt sich nicht, wie er die Welt verändern kann, sondern welches Buch er als nächstes lesen soll.«
Wahrheitsskepsis und eine Aversion gegen Knoblauchfahnen
Nun ruft Bärfuss nicht etwa dazu auf, sich von der Leselust zu verabschieden. Vielmehr regt er dazu an, damit aufzuhören, sich moralisch zu gebärden. Moral sei als etwas zu akzeptieren, was in Reinform nicht existiere. Moral nehme erst Formen an, wenn sie mit Kunst, einer trotz des »Wissen[s], dass die Wahrheit ein Ideal, deshalb unerreichbar ist«, um »Wahrhaftigkeit« bemühten Kunst, um das kämpft, was der Fall ist. Stil und Moral ist deshalb im Wesentlichen ein Buch über Kunst, primär über literarische, zum Beispiel von Kleist. In einer »Kleistʼsche[n] Katastrophensucht« sieht er Parallelen zum eigenen Leben. Die Kleistʼschen Werke hält er mit für die »eindringlichsten, faszinierendsten, unverständlichsten, verstörendsten [.], die in deutscher Sprache geschrieben worden« seien. Der in ihnen oft verwursteten These, dass Menschen zu »falsche[n] Annahmen« über das Handeln und die Motive anderer neigten, wodurch sie sich beinahe zwanghaft gegenseitig mit »Missverständnisse[n]« und »Kränkung[en]« verunsicherten, unterstellt er epochenübergreifende Aktualität. Kleists den »Glauben an ein gesichertes Ich« unterhöhlender Wahrheitsskeptizismus fasziniere heutzutage besonders.
In Zeiten, in denen Teile der Bildungselite meinen, vor einem »postfaktische[n] Zeitalter« warnen zu müssen, einem Zeitalter der Opferung von »Standards wie Objektivität und Wahrheit«, einem Zeitalter, in dem die »Basis unserer Kritikfähigkeit«8 zu bröckeln drohe, lässt sich Bärfuss darin wohl zustimmen. Die Frage, welche Zukunft dem gen Postmoderne immer fragiler gewordenen Wahrheitsbegriff bevorsteht, ist wohl eine der wichtigsten, die es zu beantworten und natürlich weiterhin literarisch zu verarbeiten gilt. Indem Bärfuss am Beispiel des Romans Die Schwierigen von Max Frisch ein Feld konturiert zwischen einem idealtypischen »Künstler, der doch ständig nach Wahrhaftigkeit sucht«, und Figuren, die er als »Schauspieler ihrer selbst« zu demaskieren glaubt, leistet er dazu schon reichlich Vorarbeit.
Auf den Bericht, mit dem er sich über einen Theaterabend echauffiert, weil dieser durch den Knoblauchgestank einer Zuschauerin vermiest worden sei, hätte er hingegen lieber verzichten sollen. Bärfuss schreibt:
»Man fragt sich auch, ob man von einer Frau Regress fordern soll, weil man gezwungen war, ihren Knoblauchgeruch in sich aufzusaugen, was einem bald als zwar gerechtes, aber aussichtsloses Unterfangen erscheint, zumal diese Damen aus der Oberschicht häufig mit Juristen verheiratet, verbrüdert oder verschwägert sind und man nicht nur die Summe für die Anreise, die Karte und das Hotel in den Sand gesetzt hätte, sondern noch eine viel größere, die durch keinen Theaterabend zu rechtfertigen wäre.«
Drei Seiten lang dehnt er das Erlebnis aus, und so wird es den Lesenden irgendwann zu bunt. Insgesamt bleiben solche Fauxpas zum Glück Ausnahmen. Schon wegen der vielen Indefinitpronomen wünscht »man« sich, im Januar, wenn Bärfuss Göttingen besuchen wird, weiterhin von so etwas verschont zu bleiben, und erst recht, weil es bedrückt, wenn ein ansonsten den Diskurs über die Probleme der Gegenwart befruchtender Autor im Brei aus Stereotypie, Pedanterie und Selbstbedauern badet. So lange Provokationen nicht zum Selbstzweck mutieren, so lange sie den analytischen Blick schärfen, werden sie in Göttingen gewiss willkommen geheißen.
Korrektur:
In einer früheren Textversion wurde Lukas Bärfuss’ Roman »Hundert Tage« als »Geschichte über den Genozid in Uganda« bezeichnet. Es handelt sich um eine Geschichte über den Genozid in Ruanda.
- Bärfuss, Lukas: Hundert Tage. München 2010, S. 17 ↩
- Vgl. Bärfuss, Lukas: Die Schweiz ist des Wahnsinns, 15.10.2015. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/lage-in-der-schweiz-vor-parlamentswahlen-2015-trostlos-13856819.html ↩
- Altwegg, Jürg: Er hätte noch deutlicher schreiben sollen, 28.10.2015. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/debatte-um-die-schweiz-er-haette-noch-deutlicher-schreiben-sollen-13879167.html ↩
- Vasik, Monika: Nichts ist letztgültig zu definieren. Biographisch grundierte Überlegungen beim Pendeln zwischen Natur und Kultur, Widerstand und Anpassung, 20.09.2015. URL: http://www.fixpoetry.com/feuilleton/kritiken/lukas-baerfuss/stil-und-moral ↩
- Vgl. Ebel, Martin: Starke Bohrer, starke Bilder, 17.07.2015. URL: http://www.deutschlandfunk.de/essays-von-lukas-baerfuss-starke-bohrer-starke-bilder.700.de.html?dram:article_id=325771 ↩
- Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt am Main 2015, S. 13 ↩
- Vgl. Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main 2014, S. 273 ↩
- Vgl. Kaeser, Eduard: Das postfaktische Zeitalter, 22.08.2016. URL: http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/googeln-statt-wissen-das-postfaktische-zeitalter-ld.111900 ↩