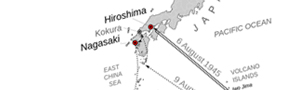Was kann uns die Wissenschaft erzählen? Mit Johannes Krause, Simone Hossenfelder und Johannes Frasnelli reden in der Paulinerkirche prämierte Forscher*innen. Ihre Vorträge zeigen, wie die Wissenschaft Narrative stiften und korrigieren kann. Wenn man die Notwendigkeit dazu erkennt.
Von Henning Bakker
Ein Mann in dunklem Pullover betritt die Bühne. Er lächelt freundlich, begrüßt das Publikum und beginnt seinen Vortrag. Ein nicht unbedingt
Reihe

Vom 18.-28. Oktober fand der 28. Göttinger Literaturherbst statt. Als Nachklapp veröffentlicht Litlog ab jetzt bis 15. November jeden Werktag einen Bericht zu den diversen Veranstaltungen des Programms.
Hier findet ihr die Berichte im Überblick.
Krause gibt zunächst einen Einblick in sein Forschungsfeld, das seine Existenz dem technischen Fortschritt verdankt. Noch vor fünfzehn Jahren konnten Maschinen höchstens 20 DNA-Analysen am Tag durchführen; 2017 waren es zweihundert Millionen. Die schiere Masse an Daten macht es möglich, dass wir von »Genetik als Zeitmaschine« sprechen können. Auch ist dadurch die genetische Analyse derart effizient und erschwinglich geworden, dass Unternehmen sie mittlerweile sehr erfolgreich für Privatkunden anbieten können.
Was sich insbesondere für deutsche Augen erst einmal gruselig liest, ist eigentlich Grund zur Hoffnung auf eine gelingende Völkerverständigung. Das Genom des Menschen hat sich seit 50.000 Jahren nicht nennenswert verändert. Konkret bedeutet das, die Gene zweier beliebig herausgepickter (moderner) Menschen sind zu 99,8 Prozent identisch. Nie zuvor in der Geschichte wussten wir so sicher, dass (und wie genau) wir alle miteinander verwandt sind. Ob wir wollen oder nicht. Krause stellt klar: Von menschlichen Rassen zu sprechen sei aufgrund dieser marginalen Differenzen wissenschaftlich unhaltbar.
Wie sich zeigt, hat der moderne Mensch (Homo sapiens) nicht nur friedlich neben dem Neandertaler, der hauptsächlich in Europa verbreitet war, koexistiert. So gab es im südostasiatischen Raum den oben erwähnten Denisovaner und in Ozeanien den Homo floresiensis. Der Kontakt war jedoch nicht nur friedlich, sondern durchaus auch mal enger. Alle Urmenschen sind genetisch voneinander zu unterscheiden, haben sich jedoch auf der ganzen Welt miteinander fortgepflanzt. Insbesondere Neandertalergene lassen sich noch heute in (beinahe) jedem von uns nachweisen.
Regionale Unterschiede zwischen Populationen, die über Jahrhunderte keinen engeren genetischen Austausch miteinander hatten, seien natürlich trotzdem entstanden. Dies betrifft Mutationen, die dem Menschen die Anpassung an seine Umwelt ermöglichten. Die Inuit haben sich auf eine allein fleischhaltige Ernährung eingestellt, Nepalesen auf einen geringeren Sauerstoffgehalt in der Luft. Krause führt aus, dass Europäer*innen nicht zuletzt ihre weiße Haut dem Umstand anzurechnen haben, dass Nordeuropa
Buch

Johannes Krause
Die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren
Ullstein:
Berlin 2019
288 Seiten, 22,00€
Nicht nur von der enormen Anpassungsfähigkeit des Homo sapiens zu erfahren, sorgt für Aha-Momente. Krause erklärt auch, dass viele Erkenntnisse auf pathogenen Fossilien beruhen, also Krankheitserregern, die die Zeit überdauert haben. Insbesondere die Ausbreitung der Pest, die sich über Jahrtausende an ihre unterschiedlichen Wirte angepasst hat, sorgte wiederum für Mutationen in den menschlichen Genen, um der Krankheit widerstehen zu können. Die Migrationskarte der Pest und ihrer Mutationen entspricht genau der Migrationskarte des Menschen.
Krauses Vortrag, der von Lachern und erstaunten Mmh!s begleitet wurde, wird nun mit begeistertem Applaus beendet. Völlig zurecht, liefert er doch wertvolles wissenschaftliches Backup – auch und gerade für die aktuellen Debatten. Denn er zeigt deutlich, dass Rassismus oder die von Rechtspopulist*innen und Rechtsextremen geschürte Furcht vor »Umvolkung« über keinerlei Substanz verfügen. Es gibt nur den einen Menschen.
Warum das Schnöde das schönere Schön istDer wissenschaftliche Teil des Literaturherbstes geht mit Sabine Hossenfelder in die zweite Runde. Hossenfelder ist theoretische Physikerin. Sie machte ihr Physik-Diplom in Frankfurt am Main mit Auszeichnung und promovierte über schwarze Löcher.
Ihr Studienfeld ist die Grundlagenforschung. Sie befasst sich also mit den »ganz großen Fragen« nach Raum und Mehrdimensionalität, Zeit und Zeitreisen, dem Universum als Ganzes. Naturgesetze also, die nicht auf noch fundamentaleren Theorien beruhen. Die Physik scheint jedoch ins Stocken geraten zu sein. Schon seit 50 Jahren haben sich die mathematischen Grundgesetze nicht mehr verändert, so Hossenfelder. Dabei wissen wir mit Sicherheit, dass wir noch viele offene Fragen vor uns haben, wir mit der Erforschung der Welt noch lange nicht am Ende sind. Warum bleiben die Entdeckungen also aus? Hat der Mensch die Grenze dessen, was er überhaupt erfahren kann, etwa bereits erreicht? Was wäre zu tun, um die Stagnation in der Physik zu durchbrechen?
Zum Einstieg zeigt Hossenfelder in einer Präsentation verschiedene Pressestimmen, die allesamt von einer »Krise der Physik« schreiben. Eine reißerische Ausdeutung, die Hossenfelder scharf kritisiert. Es werde allerorten skandalisiert und an der Oberfläche gekratzt, anstatt die richtigen (Gegen-)Fragen zu stellen. Hossenfelder: »Tun die Physiker denn, was sie können?« Ihrer Meinung nach forschten diese Wissenschaftler*innen an den eigentlichen Problemen vorbei.
Um diese zu verstehen, liefert Hossenfelder in einer gut strukturierten, ruhigen, bisweilen kühlen Vortragsweise konzise Hintergrundinformationen und nimmt somit auch jenen Teil des Publikums mit, der keinen Doktorgrad in theoretischer Physik vorzuweisen hat. So gehe es seit etwa 50 Jahren darum, die mathematischen Strukturen zweier physikalischer Theorien zu vereinfachen. Erstens die Relativititätstheorie, die Zeit und Raum, den
Buch

Sabine Hossenfelder
Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt
S. Fischer:
Frankfurt am Main 2018
368 Seiten, 22,00€
Nicht zu bestreiten, ist zum einen, dass es diese Lücke gibt und zum andern, dass sie geschlossen werden muss. Es ist allein das »Wie«, das Hossenfelder stark in Zweifel zieht. Sie formuliert ihre Kernthese »mit Blick aus der Vogelperspektive«: Die Physik verlasse sich zu sehr auf ein vages Verständnis von Ästhetik statt auf ihren eigentlichen Kern, die Empirie. Die Forscher*innen interessierten sich nicht genug für mathematische Notwendigkeiten und die Funktionalität einer Formel, sondern suche nach »schönen Theorien«, nach Vereinfachung, nach Eleganz.
Diesen Zustand führt Hossenfelder auf eine Reihe von Ursachen zurück, die sich bezeichnenderweise nicht in der Physik, sondern im Grenzbereich zwischen Psychologie und Soziologie verorten lassen. Seit Einstein habe sich der Schönheitsgedanke regelrecht vererbt. Was Hossenfelder beschreibt, ist im Grunde nichts weiter als eine zugrundeliegende fixe Idee von der Schönheit des Universums, das sich doch auch bitte mit schönen Mitteln erfassen lassen muss. Über Generationen hat sich eine Hierarchie entwickelt, die beliebte und attraktive Theorien fördere, zu Ungunsten von umständlicheren, aber möglicherweise wahrhaftigeren Konstrukten. Damit mache die Physik schlechte Methodik zur Norm, so Hossenfelder.
So etwas kann sich nur in einem Umfeld durchsetzen, das sich selbst von der Richtigkeit seiner falschen Annahmen überzeugt. Mitunter führt das zu dem Paradox, dass bereits falsifizierte Thesen unnötig verkompliziert werden, damit weiterhin Gelder in die Forschung fließen. Also zum Gegenteil von einfach, schön und elegant. Beispielsweise wenn das Teilchen, dessen Existenz man nur vermutet hatte, sich einfach nicht beobachten lassen will. Doch dafür gibt es eine einfache Lösung: Das Teilchen ist jetzt einfach »unsichtbar«, also schwerer zu entdecken. Stichwort: Dunkle Materie. Nach einer solchen Umbenennung darf dann weiter in die unnötige Forschung investiert werden.
Gesucht wird nach Gesetzen, die seit Anbeginn des Universums bestehen sollen, sich aber den wandelbaren und kurzlebigen Ansichten dessen, was schön sei, zu beugen haben. Das muss selbst den Fachfremden absurd erscheinen. Und das tut es auch, wie sich an den anschließenden Zuschauerkommentaren zeigt: Beinah jede Frage wird von Dank für den spannenden Einblick eingeleitet. Und nicht wenige betonen die Grenzübertritte zwischen Physik und Soziologie. Aber was soll man machen? Seit Johannes Krause wissen wir, dass auch Physiker*innen genetisch nicht von den »normalen« Menschen zu unterscheiden sind. Und der Mensch ist nun mal ein soziales Tier, das seine Herde liebt.
Schnupperkurs für NasenanfängerMit Johannes Frasnelli, Neurowissenschaftler und Professor für Anatomie, und seinem Vortrag über die Vielfalt der Gerüche endet die Wissenschaftsreihe des Literaturherbsts. Zu Beginn versäumt Frasnelli es nicht, von seiner persönlichen Bindung zu seinen Gastgeber*innen zu sprechen: Die zahlreichen Erzählungen seines Vaters, der selbst in Göttingen studiert habe, hätten ihm die Stadt schon früh »magisch« erscheinen lassen. Umso größer war die Freude dann darüber, sich nach diesem (ersten!) Besuch auf ganz ähnliche Weise an Göttingen erinnern zu können.
Charmant und witzig führt Frasnelli das Publikum an seinen Gegenstand heran. Um auch Nicht-Medizinern einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise der Nase zu geben, nutzt er eine projizierte Bilderstrecke: Kleine Näschen, meistens die der Schauspielerin Emma Stone, stellt er neben große Kathedralen. Der Vergleich gelingt. Und beschert Frasnelli neben einigen Lachern auch die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums. Die Enge des Eingangs und die Weite des Kirchenschiffs stellen hier Metaphern für die Nasennebenhöhlen dar. Dabei zeigt sich: Egal, ob Stupsnase oder Riesenzinken – wir sind alle von innen hohl.
Anders als beim Seh- oder Gehörsinn, die Signale über weite Strecken wahrnehmen können, nehmen wir Duftstoffe direkt in unseren Körper auf. Ein einziges Molekül reicht dafür zum Glück bereits aus. Über das Einatmen oder den Rachenraum wird es über die Nasengänge zu den Riechnerven befördert und von dort in einen »verständlichen Geruch« übersetzt.
Übrigens: Ein ganzer Zeigefinger hätte in unserer Nase Platz, bis man zum Gehirn vorstößt. Also, theoretisch.
»Theoretisch« ist aber auch das Prädikat, das den Rest des Vortrags zusammenfasst. Frasnelli erklärt weiterhin gut verständlich und weitgehend voraussetzungsarm, lässt aber im weiteren Verlauf den Esprit des Anfangs vermissen. Die Vermittlungsweise ähnelt im weiteren Verlauf des Abends
Buch

Johannes Frasnelli
Wir riechen besser als wir denken. Wie der Geruchssinn Erinnerungen prägt, Krankheiten voraussagt und unser Liebesleben steuert
Styria:
Wien 2019
176 Seiten, 23,00€
Überhaupt erfährt man nur wenig über die Zusammenhänge zwischen Riechen, Erinnerung und Krankheit – Erwartungen, die durch den Untertitel von Buch und Vortrag geweckt wurden. Unterm Strich: Gerüche können starke psychologische Anker sein, die uns beim Wiedererkennen an die exakten Umstände des »ersten Mals« erinnern. Außerdem: Wer den Geruchssinn verliert, könnte in zehn bis fünfzehn Jahren an Alzheimer oder Demenz erkranken. Doch weder lässt dieser Fakt eine gesicherte Prognose zu, noch lässt sich etwa – wie erst eine Nachfrage aus dem Publikum ergab – das Gedächtnis durch eine Schärfung des Geruchssinns trainieren. So schmückt Frasnelli, überspitzt gesagt, nur mit mehr Details aus, was der Alltag uns bereits gelehrt hat.
Frasnelli stiftet also kaum lebensweltliche Bezüge und scheitert, anders als Krause und Hossenfelder, an der Einbindung seiner Forschungsergebnisse in eine auch außerhalb der Wissenschaft nutzbare Erzählung. Ein vielversprechender Abend und mit ihm die Wissenschaftsreihe des Literaturherbsts, klingen leider recht belanglos aus. Schade.