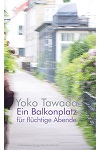Yoko Tawada schreibt Gedichte, Prosa, Romane, Theaterstücke und Essays auf Deutsch und Japanisch. Dafür hat sie bereits einige Preise bekommen und dieses Jahr kommt der Kleist-Preis dazu. Und sie hat einen neuen Roman geschrieben. Über Hamburg. Es geht um die junge Loreley, die sich an die Elbe verläuft.
Von Joana Kolbach
Die Loreley an der Elbe? Sagenkenner dürften jetzt die Stirn runzeln. Was macht eine Sagengestalt, die eigentlich am Rhein beheimatet ist, an der Elbe? Sie begegnet Menschen. Zuerst und zuletzt der jungen Frau Elsa, der personifizierten Elbe, die sie die gesamte Geschichte über in all den Begegnungen, die sie macht, begleitet wie ein rettender Anker.
Elsa summt auf ihrem Balkon.
Ein Fährmann im blau karierten
Hemd seufzt und bleibt stehen unter einer
Loreley, die sich an die
Elbe verirrt hat.
Auf ihrer Reise durch Hamburg, die ein bisschen an James Joyce’ Ulysses erinnert, lernt die Loreley ihre Fluss-Freundin Elsa, den Philosophen-Dichter-Angestellten Wermut/Chris, ein Nashorn und noch viele Menschen mehr kennen, die namenlos bleiben. In der Kneipe, in der S-Bahn, am Strand – überall finden die Begegnungen statt wie eine poetische Stadtführung durch eine Hansestadt, die jeder irgendwie kennt und die Tawada doch in neuem Licht erstrahlen lässt, fernab der Touristen. Insgesamt sind die Personen jedoch wenig greifbar, wenig konkret und verschwimmen immer wieder, denn die Loreley als Erzählerin zieht keine klaren Grenzen zwischen den Personen, denen sie begegnet.
Die Loreley nimmt diese alltäglichen Begegnungen verschieden war. Mal ist sie naiv, wenn sie einen Schiffer beim Schiffen beobachtet; mal verstohlen, als sie Chris im Botanischen Garten das erste Mal sieht: mal ganz erwachsen und abgeklärt, wenn sie in der Kneipe auf Elsa wartet. Eine Selbstverständlichkeit, wie man Dinge wahrnimmt oder eben nicht, gibt es für die Loreley nicht. Und immer lässt Tawada Teil haben an der Gedankenwelt ihrer Hauptfigur.
Besonders sind auch die Türen in andere Welten, die sich hin und wieder öffnen. In einer Kneipe zum Beispiel findet die Loreley den Durchgang zu einem orientalischen Bazar, der so völlig anders ist als die Hansestadt.
Ich öffne eine Tür, ich weiß nicht welche,
es spielt keine Rolle, ziehe
den jungen Mann mit hinein. Die trübe
Glühbirne verdunkelt sich und wenn sie wieder
leuchtet, liegt vor mir ein Bazar,
mit z geschrieben.
Immer wieder öffnen sich solche Türen, die in andere Welten entführen, die wie Träume wirken. Überhaupt gibt es im Roman keine Grenzen, weder zwischen Realität und Fiktion, noch zwischen Mann und Frau, zwischen Kindheit und Erwachsensein. So ist Chris am Anfang ein Philosoph, den die Loreley zu lieben glaubt. Doch heiraten will sie ihn nicht. Später betrachtet sie Kunstpostkarten, auf denen tanzende Menschen abgebildet sind, die die Loreley vollkommen in ihren Bann ziehen. Da hört sie plötzlich ein kleines Kätzchen miauen, welches sie entgegen ihrer Intention mitnimmt. Und in diesem Kätzchen, das bei Elsa und der Loreley zu einem Kater heranwächst, glaubt sie Chris zu erkennen, obwohl der echte Chris längst der Vergangenheit angehört. Dann wird die Loreley wach und man fragt sich, was Realität und was Traum an dieser Episode ist.
Aus dem Kätzchen wird ein Kater,
durch seine Schnauze lächelt Chris.
Der Schreck öffnet meine Augen und
ich liege im Bett, neben mir Elsa mit einem
Kätzchen in den Armen.
Der Text folgt keinem stringenten Handlungsaufbau. Es muss nicht zuerst das passieren, damit jenes geschehen kann, sondern alles ist im Fluss und verändert sich. Das wirkt spontan, ungekünstelt.
Tawadas Roman ist vieles: sinnlich-erotisch, charmant, naiv, magisch, verträumt, aber auch der harten Realität verhaftet. Dennoch sind diese flüchtigen Treffen keinesfalls bedeutungslos. Sie hinterlassen Eindruck – jedenfalls beim Leser.
Der Text geht nahtlos über von einer Zufallsbegegnung in die nächste, ohne dass man jedoch den Eindruck hätte, die Autorin würde wilde Gedankensprünge vollziehen. Es gibt keine harten Kanten, vielmehr gleitet man auf dem Text-Fluss durch Hamburg. Und Fluss ist hier das Stichwort: Das vorherrschende Thema des Romans ist das Wasser, das Fließen. Nicht umsonst verspricht der Paratext einen Text »[…] wie Wasser, fließender und freier als Prosa, aber doch ein erzähltes Werk, ein poetischer Roman.« Der Roman liest sich wie ein einziges, langes Gedicht. Aber das ist wahrscheinlich der Trick am ganzen, dass man sich fragt, ob Ein Balkonplatz für flüchtige Abende nun Poesie oder Prosa ist. Die Grenze scheint genauso fließend wie der Text selbst.
Es geht um Kunst, aber nicht nur Kunst, die auf Bildern oder Postkarten festgehalten ist, sondern um die Kunst der zwischenmenschlichen Interaktion. Die Dinge sind im Wandel, auch bei der Loreley. So lernt die Loreley nicht nur viel über andere, sondern auch über sich selbst.
Aber am Ende sind die Unterschiede unerheblich. Es gibt keine Grenzen, nicht einmal mehr zwischen den Menschen oder zwischen Text und Bild. Denn im Text sind Bilder eingefügt, die mal daneben stehen, mal zwischen den Buchstaben hindurchschimmern.
Der Titel Ein Balkonplatz für flüchtige Abende klingt für den Leser erstmal nach Sommer. Nach einem Buch, das man am Strand liest oder zu einer Fahrradtour ins Grüne mitnimmt. Nach dem Geruch des Sommers, den man nach einem ereignisreichen Tag mit nach Hause bringt. All das trifft zu, aber der Roman ist noch viel mehr. Die flüchtigen Begegnungen, die die Loreley macht, sind geprägt von einer Tiefe, die man bei spontanen Begegnungen nicht erwartet. Trotzdem ist der Roman nicht schwergängig. Für zwischendurch ist Ein Balkonplatz für flüchtige Abende aber trotzdem nichts. Man sollte die Zeit nehmen, sich im Roman treiben lassen. Beim Morgenkaffee immer mal ein paar Zeilen zu lesen, würde den Zauber des Romans verpuffen lassen, ein Zauber, dem sich selbst jemand, der eigentlich nichts mit Gedichten am Hut hat, nicht entziehen kann. Tawadas Roman lässt sich denn auch mit einem Wort beschreiben: märchenhaft.