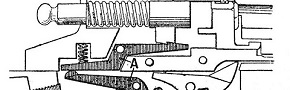Die Vernunft ist tot. Weil sie mit Passagen aus Carolin Emckes Friedenspreis-Rede zur Courage aufrief, haben ihr die Feinde der offenen Gesellschaft den Brustkorb zermalmt. Mit Max Frischs Andorra packt das Schauspiel Hannover das Publikum dort, wo es wehtut.
Von Stefan Walfort
In der Rolle der Bürgermeisterin tritt Katja Gaudard ans Mikrofon und spricht die ZuschauerInnen an als »liebe Juden und Jüdinnen«, als »Neuandorraner und Neuandorranerinnen«, als Gäste einer »Welcome-Gala«, die vor kurzem jede Menge Krimskrams für Geflüchtete gespendet hätten. Der Bühnenbereich des Ballhof Eins ist zur Sporthalle hergerichtet. Auf dem Boden zeichnen sich die Konturen eines Spielfeldes ab. Im Hintergrund sind Pritschen zu sehen. Darauf stapeln sich Decken und Kissen und Kleidung, und an der Decke baumelt eine Girlande aus weißen Ballons. Hinter einem Bauzaun, der die Bürgermeisterin vom Publikum abschirmt, wirkt sie trotz des Anspruchs, eine festliche Atmosphäre zu verbreiten, besorgt. Wie sie die Summen von Plüschtieren und T-Shirts aufzählt, wie sie einen klapprigen Drahtesel vorführt und dessen Spender mit Lob überschüttet ‒ alles an ihr wirkt verkrampft. Alles dient nur der Selbstvergewisserung. Es ist, als seien die »dunkle[n] Zeiten«, an die im Folgenden durch ein Bühnenstück erinnert werden solle, noch längst nicht ausreichend aufgearbeitet. In den Stolz auf das Engagement einer neuen Generation mischt sich Argwohn. Jederzeit, so lässt sich erahnen, rechnet das Stadtoberhaupt mit einer Neuauflage von mörderischen Aggressionen.
»Ich kenne den Jud.«
Statt Andorras Bevölkerung beim Bepinseln der Häuser mit weißer Farbe zu zeigen, steht im Mittelpunkt des Spiels im Spiel der zum Juden gestempelte Andri (Günther Harder). Dessen Vater hatte sich einst damit gebrüstet, ihn, ein Judenkind, vor den verfeindeten »Schwarzen« aus der Nachbarregion gerettet und in Obhut genommen zu haben. Die Wahrheit hingegen lautet: Andris Existenz ist das Ergebnis eines Techtelmechtels mit einer der »Schwarzen« und der Vater (Andreas Schlager) zu feige, das zuzugeben. Die Konsequenzen sind katastrophal: Inzwischen boomt in Andorra der Antisemitismus, und Andri fängt an, Teile des Fremdbilds in sein Selbstbild zu integrieren. Gemäß einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung bestätigt fortan all sein Handeln die Stereotype.
Zu Andris zwanzigstem Geburtstag gibt es eine Sause mit Sekt und bunten Lampen und ‒ selbstverständlich ‒ Geschenken. Statt ihn zu erfreuen, jubeln ihm die Gäste lauter Gedöns unter, mit dem sie ihre Ressentiments manifestieren: einen Lockenstab für Schläfenlocken, obwohl auf seinem Kopf eine gewöhnliche Kurzhaarfrisur sprießt und er auch sonst mit Orthodoxie nichts am Hut hat, ein Portemonnaie, um das viele Geld zu verstauen, über das »der Jud« ja bekanntlich verfüge. Jemand drückt ihm Kants Kritik der reinen Vernunft in die Hände, jemand anderes ein T-Shirt mit dem Aufdruck »I love Israel«.
Feindseligkeiten gehören zum Alltag. Während die Tischlerin (ebenfalls Gaudard) sie zu Witzen verklärt, stilisiert sich der Arzt zum Opfer jüdischer Omnipotenz, wegen der er sich um seine Karriere betrogen fühlt: »Ich kenne den Jud. Auch ich habe Juden gerettet. Und was ist der Dank? Auf allen Lehrstühlen der Welt hockt er.« Mathias Max Herrman spitzt die Rolle des Ekelpakets, das unentwegt herumposaunt, für wie integer es sich hält, mit reichlich Chuzpe zu: Erst streift er sich mit Genuss, Finger für Finger, weiße Handschuhe über ‒ eine symbolische Geste, mit der er signalisiert: Meine Weste bleibt blütenrein. Dann knöpft er mit dem gleichen Gestus die Bluse der in Passivität verharrenden Schwester von Andri (Vanessa Loibl) auf, um sie zu vergewaltigen. Erst demontiert er gemeinsam mit dem Wirt (Frank Wiegard) den Bauzaun, um Andris Mutter (wiederum Gaudard) zwischen zwei Elementen zu zerquetschen. Dann stimmt er ohne zu zögern in den Plan ein, Andri die Tat in die Schuhe zu schieben. Schuld an allem kann ja nur er sein. »Wer sonst?« ‒ so feixen die beiden siegesgewiss und die jedem Antisemitismus inhärente Logik unverblümt aussprechend.
Auch den Mord an der Mutter wissen sie rasch zu rationalisieren: In alten Wunden zu wühlen und Andris Vater in Erklärungsnot zu bringen, musste doch genügen. Warum also obendrein ganz Andorra anklagen? Nur wegen des bisschen Spotts über Andri? Feindbilder sind dekonstruierbar, so lautet die Botschaft, die die Mörder am meisten schmerzt. »Hier waren die Grenzen überschritten«, das steht für die beiden fest.
Denunziation von Diskursen
Es war ein teils feuriges, teils elegisches Plädoyer, mit dem sich Andris Mutter an das Publikum gerichtet hat. Sie hat erinnert an eine einstige Utopie der »Schwarzen«. Die sei gescheitert, weil sich auch auf ihrem Territorium die Feinde der offenen Gesellschaft durchgesetzt hätten. Doch die Zuversicht könne jederzeit erneuert werden: »Wir können sprechen und handelnd eingreifen in diese sich zunehmend verrohende Welt. Da ist jede und jeder relevant, alte Menschen und junge, die mit Arbeit und die ohne, die mit mehr und die mit weniger Bildung, Dragqueens und Pastoren, Unternehmerinnen und Offiziere, Rentnerinnen und Studenten, jede und jeder ist wichtig, um eine Geschichte zu erzählen, in der alle angesprochen und sichtbar werden. Wir dürfen uns nicht nur als freie, säkulare, demokratische Gesellschaft behaupten, sondern wir müssen es dann auch sein.«1
Das sind Auszüge aus der Rede Carolin Emckes, der Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels 2016. Emcke hat dafür maßlos überzogene Kritik einstecken müssen. Bereitwillig stimmten Teile des Feuilletons ein in den Chor derer, die es sich dieser Tage leicht machen und die Schuld am Erstarken menschenfeindlicher Positionen der Political Correctness von vermeintlich elitären Zirkeln anlasten: »Es ist geradezu, als würde der zweideutig unangreifbare Diskurs die Gewalt provozieren, von der er so entschieden Abstand nimmt, und jener ›eigentümlichen Kombination aus Selbstmitleid und Brutalität‹ Vorschub leisten, die er zu Recht bei Fanatikern anprangert.«2 Wer so argumentiert, macht Täter zu Opfern und spielt denen in die Hände, die sich nichts sehnlicher wünschen als eine möglichst einhellige Denunziation für die Pluralität streitender Diskurse. Weil auf »einen, der sie [die Nazis] Nazis nennt, hundert kommen, die dem widersprechen«, weil das »Verständnis, das sie überall fanden, [.] sie gesellschaftsfähig gemacht und ermutigt« hat3, ist Emckes Rede als Korrektiv einer ins gefährlich Abstruse zu driften drohenden Debatte zu wertschätzen. Ihre Worte in Frischs Stück zu integrieren, ist ein genialer Einfall. Statt einer Katharsis gibt es klare Ansagen. Statt einer Zeugenschranke, an der ganz Andorra vor Selbstmitleid zerfließend jede Schuld von sich weist, gibt es Figuren, deren Coolness den Zynismus der Gegenwart spiegelt. Statt einer an die NS-Selektionen erinnernden »Judenschau« gibt es einen Antisemitismus, dessen Potenzial, Antisemitismusvorwürfe von sich zu weisen, der derzeit populärsten von vielen möglichen Varianten entspricht.
Was Theater leisten kann
Das 1961 in Zürich uraufgeführte und »zu den meistgespielten deutschsprachigen Dramen des 20. Jahrhunderts«4 zählende Stück als Spiel im Spiel darzubieten, ist nicht nur innovativ. Die Dramaturgin Barbara Kantel und die Regisseurin Babett Grube stellen sich damit auch dem Dilemma, das die Nachtkritik-Rezensentin Geneva Moser nach der Andorra-Premiere des Züricher Schauspielhauses im Mai letzten Jahres zu einem ernüchternden Fazit veranlasste: Warum »das Publikum [.] auf sicherer Distanz gehalten« wurde, wollte sie wissen. Wegen »der sich aufdrängenden Aktualität« hielt sie das für »fatal: Warum nicht mutiger fragen, nicht mehr Provokation und Risiko eingehen?«5 Genau das soll in Hannover das Ziel sein. Zu Recht problematisieren Kantel und Grube im Programmheft die Interpretationsoffenheit einer Parabel. Viel zu oft lädt sie dazu ein, mit dem Finger auf die Figuren zu zeigen und sich zurückzulehnen in dem Glauben, nicht betroffen zu sein. Doch ist sie nicht auch ein gattungskonstitutives Merkmal? Inwieweit steht es Theaterschaffenden zu, sie zugunsten einer spezifischen Lesart zu beschränken? Sind Fälle denkbar, in denen Theater unbedingt mit Ambiguitäten geizen sollte? Und wenn ja, ist Andorra so ein Fall? Die mit 75 Minuten Spielzeit besonders kurzweilige Adaption kann all das nicht abschließend klären. Doch der Mut, sich weitgehend vom Primärtext zu lösen und dadurch den Diskurs darüber anzuheizen, tut seit Langem not.
Nicht alle Facetten lassen sich an dem Abend aufgreifen. Die Liste der Einwände gegen Frischs Stück ist lang, und es ist illusorisch zu glauben, Theater könne sie alle entkräften. Schwer wiegt der Vorwurf, statt Antisemitismus zu demaskieren, reproduziere Frisch ihn. Zwar zeige er, wie die antisemitische Projektion funktioniert, nur richte sie sich halt nicht gegen einen Juden. Deshalb sei es möglich, einen Umkehrschluss zu denken, demzufolge das Unrecht gegenüber Andri kein Unrecht mehr sei, wenn er tatsächlich Jude wäre.6 Doch sind dem Theaterpublikum derart haarsträubend scheinende Blickwinkel zuzutrauen? In der Literaturwissenschaft fordern solche Gedankenexperimente zur Polemik heraus.7
Wer aber rein intuitiv dazu neigt, die nicht nur rhetorisch gemeinte Frage zu verneinen, sei darauf verwiesen, dass Antisemitismus kein Phänomen ist, vor dem gebildete Milieus gefeit sind. Zudem gesellt sich zu dem parabolischen Dilemma auch noch ein performatives: »Durch die Thematisierung und Fokussierung von Differenz wird diese erst hergestellt. […] Damit besteht für differenzbezogene Ansätze die Gefahr, die Differenzen, die eigentlich infrage gestellt und überwunden werden sollen, in der Anrufung und durch die Benennung zu perpetuieren.«8 In Hannover sind Kantel und Grube der Gefahr nicht ausgewichen. Sie haben, beispielsweise durch die am laufenden Band perfide Sprüche plappernde Tischlerin, versucht, sie weit auf die Spitze zu treiben ‒ bis sie sich selbst subvertiert. Das ist ein heikles Unterfangen. Zunehmend beginnen Teile der Gesellschaft, Nazivokabular für unproblematisch zu halten. Unter den MultiplikatorInnen von Hatespeech tummeln sich auch Intellektuelle.9 Zudem ist Rezeption ein individueller und multifaktoriell beeinflusster Prozess. Nicht jede Eventualität kann Theater vorhersehen. Theater kann aber auf einem schmalen Grat wandeln und ihn dadurch sichtbar machen.
Max Frisch hat nie mit Selbstkritik gespart. Ihretwegen überarbeitete er seine Texte umfassend, und doch blieb er dabei unzufrieden: »Die meisten Menschen haben ein Glück, dessen sie sich nie bewußt werden: Sie brauchen nicht zu hören, was sie vor Jahrzehnten gesagt haben, und nicht zu sehen, wie sie sich vor Jahrzehnten bewegt haben. Der Schriftsteller, ob er will oder nicht, ist dieser Prüfung unterworfen und zwar öffentlich.«10 Das gleiche gilt für die Theater. Ihnen obliegt es, auf der Grundlage ihrer Selbstkritik Texte an sich verändernde gesellschaftliche Kontexte anzupassen und dabei den Konflikt nicht zu scheuen. Weil das in Hannover auf ganzer Linie gelang, heimste das Ensemble lang anhaltenden Applaus ein.
- Emcke, Carolin: Anfangen. URL: http://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/1244997/; letzter Aufruf: 07.01.2017. ↩
- Alexander García Düttmann: Eine heimelige Wiedererkennbarkeit, 02.11.2016. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/friedenspreis-rede-von-carolin-emcke-nachbemerkungen-14507818.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2; letzter Aufruf: 07.01.2017. ↩
- Vgl. Gremliza, Hermann L.: Drum rechts, zwei,drei, in: Konkret 1/2017, S. 9. ↩
- Hage, Volker: Max Frisch, Reinbek bei Hamburg 1997, S. 8f. ↩
- Vgl. Moser, Geneva: Rassismus im Guckkasten, 04.05.2016. URL: http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=12506:andorra&catid=38&Itemid=40; letzter Aufruf: 07.01.2017. ↩
- Vgl. Thurn, Nike: ›Blut und Holz‹. Zur Ambivalenz des Aufzeigens und Aufweisens von Antisemitismus in Max Frischs ›Andorra‹, in: Der Deutschunterricht, H. 2, 2015, S. 59. ↩
- Vgl. Müller-Salget, Klaus: Max Frisch zwischen Dekonstruktion, Denunziation und postkolonialer Zurichtung. Zu neueren Publikationen von Yahya Elsaghe, Franziska Schößler und Melanie Rohner, 08.08.2016. URL: http://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=20856; letzter Aufruf: 07.01.2017. ↩
- Riegel, Christine: Bildung ‒ Intersektionalität ‒ Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen, Bielefeld 2016, S. 112. ↩
- Vgl. Röpke, Andrea: 2017 Jahrbuch rechte Gewalt. Chronik des Hasses. Hintergründe, Analysen und Ereignisse 2016, München 2017, S. 10-43. ↩
- Hage, Volker: Max Frisch, Reinbek bei Hamburg 1997, S. 78. ↩