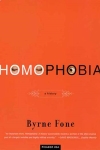Es ist Juni und das heißt: Es ist wieder Pride Month! Zu diesem Anlass haben Litlog-Autor:innen für euch eine bunte Liste mit Empfehlungen zusammengestellt. Ob schon älter oder ganz aktuell – diese fünf LGBTQ Bücher, Filme und Serien solltet ihr auf keinen Fall verpasst haben.
You can read this article in English here.
Triggerwarnung: Queerfeindlichkeit
Als wir tanztenVon Sebastian Kipper
Zur Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes 2019 gab es für Als wir tanzten noch viertelstündigen stehenden Applaus. Der deutsche Filmstart im April 2020 wurde dann aber von der Corona-Pandemie überschattet. Das ist sehr zu bedauern, handelt es sich bei dem schwedisch-georgischen Film doch um einen spannenden zeitgenössischen Beitrag zum immer internationaler werdenden Queer Cinema.
Als wir tanzten zeigt den Nachwuchstänzer Merab (Levan Gelbakhiani), der seit seiner Kindheit im georgischen Nationalensemble trainiert. Sein Traum ist es, als professioneller Tänzer die Welt bereisen zu können. Während des Trainings muss Merab jedoch wiederholt Kritik von seinem Tanzlehrer aushalten, demzufolge seine Art zu tanzen nicht den Ansprüchen des traditionellen georgischen Tanzes genüge. Zusätzlich sieht sich Merab durch den Neuen in der Gruppe, Irakli (Bachi Valishvili), unter Druck gesetzt, der sich in den Proben als ein talentierter Tänzer behaupten kann. Zunächst scheint es, als ob sich zwischen Merab und Irakli eine Rivalität entwickelt, nachdem bekannt wird, dass ein Platz im Hauptensemble frei ist. Doch aus Konkurrenz wird bald Begehren, das sich während eines Ausflugs Bahn bricht. Einzig: Mit ihrer Liebesbeziehung riskieren beide Tänzer ihre potenzielle Karriere.
Was Als wir tanzten daher auch zeigt, ist eine Gesellschaft, in der alle von der Norm abweichenden geschlechtlichen und sexuellen Identitäten sanktioniert werden. Der Platz im Hauptensemble wurde vakant, weil ein Tänzer beim Sex mit einem Mann erwischt wurde. Für Merab, der als Tänzer erfolgreich werden möchte, um der Armut seiner Familie und der desolaten wirtschaftlichen Lage seines Landes zu entfliehen, steht mit der Aufdeckung seiner Homosexualität auch seine Existenz auf dem Spiel.
Film-Info
Schweden/Georgien 2019
105 Minuten
Regisseur: Levan Akin
Mit: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili und anderen
Auch der traditionelle georgische Tanz wird instrumentalisiert, um ein regressives Bild von Männlichkeit in der georgischen Kultur und damit auch in der nationalen Identität zu verankern. »Der georgische Tanz basiert auf Männlichkeit«, wird Merab von seinem Tanzlehrer belehrt. Und folglich sei dort auch »kein Platz für Schwäche«. Eine stramme Haltung mit durchgedrücktem Rücken und rausgedrückter Brust, kontrollierte Bewegungen – bestimmte Arten des georgischen Tanzes sollen soldatische Strenge und männliche Kraft symbolisieren, zur Schau gestellt zu Trommelschlägen und Akkordeonmusik.
Als wir tanzten zeigt nicht zuletzt auch Merabs künstlerischen Ausbruch aus dieser eingedrillten Doktrin. Fernab des Proberaums, katalysiert durch sein schwules Begehren, findet er Zugang zu einer anderen Art zu tanzen. Zwar scheinen Merab und Irakli keine Worte für ihr Beziehung zu haben, über die in der georgischen Gesellschaft ohnehin geschwiegen werden soll, aber mittels des Tanzes finden beide trotzdem zu einer gemeinsamen Sprache. Ebenso wortlos findet auch Merabs Coming-out statt: Während seines Vortanzes für das Auswahlverfahren vermengt er in einer eindrucksvollen Performance die aus den Proben bekannten Tanzschritte mit dem neu entdeckten Körpergefühl– und queert somit den georgischen Tanz.
Die Verknüpfung von Homosexualität mit dem traditionellen georgischen Tanz war für viele allerdings eine zu große Provokation. In Georgien wurde die Premiere von Als wir tanzten Zielscheibe von Massenprotesten, organisiert von rechtsradikalen Gruppierungen. Der Film konnte nur durch den Schutz der Polizei in den georgischen Kinos gezeigt werden. Auch die orthodoxe Kirche verunglimpfte den Film. In einem Interview, das Teil des DVD-Bonusmaterials ist, erklärt Regisseur Levan Akin – der selbst ursprünglich aus Georgien stammt, aber in Schweden aufgewachsen ist –, dass sich Homofeindlichkeit als Norm in der georgischen Gesellschaft hartnäckig halte, weil die meisten Georgier:innen keine queeren Menschen kennen, die die diskriminierenden Bilder widerlegen könnten, die von ultrakonservativen Gruppen und der Kirche verbreitet werden. Es zeigt sich daher, wie wichtig die empathische mediale Repräsentation queerer Menschen ist, um zementierte homofeindliche Ressentiments aufzubrechen.
Trotzdem stellt Akins Film keine Abrechnung mit der georgischen Kultur dar, sondern zelebriert ihren Tanz und Gesang vielmehr. Mit Als wir tanzten gelingt es ihm, mittels der schwulen Liebesgeschichte zweier Nachwuchstänzer das Bild einer Nation zu zeichnen, die sich zur Vergewisserung der eigenen nationalen Identität an den traditionellen Tanz klammert. Und er führt beispielhaft vor Augen, wie sich dieser künstlerisch erneuern lässt, wenn das starre Konzept von Männlichkeit aufgebrochen und Fluidität zugelassen wird.
Ife-Chudeni A. Oputa: RummageVon Hanna Sellheim
Zu mir sagte mal jemand: »Gedichte sind ja ganz nett, aber die machen doch keinen Sinn.« Rummage (dt. kramen) von Ife-Chudeni A. Oputa ist einer jener Bände, die das Gegenteil beweisen. In vier Abschnitten erzählt Oputa darin erst von Kindheit und Erwachsenwerden (We Are Sitting Around Discussing Our Shame), dann von einer Trennung (A Brief History of She), vom Körper (Lessons on the Body) und vom Weltschmerz (All the Dead Call You Friend). Oputa war Fellow des US-amerikanischen Literatur-Kollektivs Lambda Literary, das nicht nur Preise an LGBTQ-Autor:innen verleiht, sondern auch Stipendien an sie vergibt und Schreibworkshops veranstaltet.
Dennoch würde man (wie so häufig) einen Fehler begehen, läse man Rummage allein auf seine queere Thematik hin. In dem schmalen Gedichtband steckt viel mehr als das; von der Verarbeitung von Rassismus-Erfahrungen (Tunnels) über die Auslotung einer Schwesternbeziehung (Mosaic in Nine Lives) bis hin zu Reflektionen zur Evolution (Portrait of Memory with Evolution). Immer wiederkehrendes Thema ist die Scham, die Oputa im ersten Gedicht Ode to Shame anhand des geschickt gewählten Symbols der Esche, Namensgeberin ihrer kalifornischen Heimatstadt Fresno (das spanische Wort für Esche, zu Englisch ash tree, also Aschenbaum), einführt.
Oputa gelingt es, die Trauer nach der Trennung, die Einsamkeit und den Schmerz, genau einzufangen und in Worte zu fassen. Sie schreibt auf beeindruckend schöne Weise von Sehnsucht und Veränderung. Besonders eindrücklich ist die Erkundung des Metaphernfeldes von Prisma/Kaleidoskop/Mikroskop in der Verbindung mit der Typographie in Transition:
* * * * *
A single ray of light passes through a prism’s blade
and it is a million rays of light. It is a billion molecules
of no. A trillion atoms of stay–
and then it is not.
*
Die Dreiteilung des Gedichts strukturiert den beschriebenen Veränderungsprozess, der schließlich in dialektischer Auflösung endet: »Everything looks alien / when seen through another lense– […] Pull the eye back from the glass, / blink let it come into focus«
Gleichzeitig keimt in den Texten die Hoffnung: Im letzten Gedicht wird das wiederkehrende Motiv des Schweigens, der ausbleibenden Antwort, endlich durch einen Chor beantwortet; das durch seine Länge herausstechende Gedicht Girls as Matryoshka Dolls; or, a Brief History of She endet mit dem Versprechen eines »new myth all your own«; und in On the Early Arrival of Spring beschreibt die für den ersten Frühlingstag viel zu warm gekleidete Sprecherin eine Begegnung mit einem Gegenüber in gemusterten Strumpfhosen, das sie eine Ex-Freundin vergessen lässt und einen neuen Anfang verheißt: »Made me remember // how good the glint of the strange can be // when you stumble / toward it. When you look on // without stopping–«
So kann der Band nicht nur als Kollektion einzelner Gedichte, sondern auch im Ganzen als ein Selbstfindungsprozess gelesen werden, in dem das lyrische Ich Queerness als Teil der eigenen Identität verortet und damit die von außen aufgebürdete Scham überwindet. So viel zur Sinnhaftigkeit von Gedichten.
Byrne Fone: Homophobia. A HistoryVon Philip Flacke
»Die COVID-19-Pandemie hat zu einem noch größeren Umfang von Gewalt und Diskriminierung gegen LGBTI-Personen geführt«, heißt es unzweideutig in der offiziellen Erklärung der EU zum diesjährigen IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Die Auswirkungen der Pandemie auf queere Menschen sehen je nach Land, dazukommenden Diskriminierungserfahrungen und sonstigen Umständen sehr unterschiedlich aus. Teilweise sind sie sehr ernst, auch in Deutschland.
Währenddessen fällt manchen religiösen Autoritäten nichts Besseres ein, als der LGBTQ-Community die Schuld für das Virus in die Schuhe zu schieben. Im Verlauf der ersten Welle in der Türkei erklärte Ali Erbaş, Präsident für Religionsangelegenheiten, Homosexualität und Ehelosigkeit führten Krankheiten herbei, – was Staatspräsident Erdoğan »von vorne bis hinten korrekt« fand. Der ukrainische Patriarch Filaret nannte das Virus eine Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschheit, vor allem die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Liste ließe sich fortsetzen. Männer wie Filaret und Erbaş sind Ausnahmen auch in ihren Glaubensgemeinschaften, aber Ausnahmen mit Rang und Namen.
Die Rede von epidemischer Queerness ist seit HIV/Aids besonders schmerzhaft, aber sie ist ungefähr ebenso alt wie die Interpretation der Sodom-Geschichte als homophober Ur-Mythos. Der Gelehrte Philon von Alexandria, der um die Zeitenwende lebte, malte sich das Leben in Sodom in grellen Farben aus: Gleichgeschlechtliches Begehren ist für ihn eine Krankheit. Sie richtet den Körper zugrunde, überträgt sich von einem:r auf den:die nächste:n und breitet sich aus wie eine Seuche.
Mit welch bemerkenswerter Konsistenz sich stereotype Metaphern und Behauptungen durch mehrere Jahrtausende der Homophobie hindurchziehen! Nachverfolgen lässt sich das anhand von Homophobia, A History, einem Buch des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Byrne Fone. Triggerwarnung: Darin kommen mehrfach auch Missbrauchsvorwürfe zur Sprache. Erschienen vor zwanzig Jahren ist das Buch nicht neu. Während auf Spanisch sogar eine Übersetzung vorliegt, scheint es im deutschsprachigen Raum allerdings nur wenig Resonanz bekommen zu haben. So weist der Verbundskatalog GVK allein ein einziges Exemplar, in der SUB Hamburg, aus. Demnächst wird hoffentlich eines in Göttingen hinzukommen.
Fone gibt einen Überblick von der griechischen Antike bis ins zwanzigste Jahrhundert. Der Begriff ›Homophobie‹ ist eigentlich zu eng für Fones Gegenstand. Er untersucht die vielfältigen Formen von Ablehnung, Diskriminierung und Verfolgung von Menschen, die Menschen ihres eigenen Geschlechts lieben oder begehren, und von solchen, die sich quer zu den von ihnen erwarteten Geschlechterrollen verhalten. Dieser weite Gegenstandsbereich ist sinnvoll, allerdings würden heutige Leser:innen sich mehr Sensibilität von Fone wünschen, auf keinen Fall den Eindruck entstehen zu lassen, als sollten vielleicht Transfrauen, die Männer lieben, unter Homosexuellen subsumiert werden.
Die Bedeutung von Intersektionalität für Diskriminierungsmechanismen ist Fone bewusst: »Homophobie hat Verbindungen mit Sexismus ebenso wie mit Antisemitismus und Vorurteilen gegenüber People of Color.« Diskurse über Frauen kommen deutlich kürzer als solche über Männer; Kolonialgeschichte, die allzu häufig auch den Export homophober Weltbilder und Gesetzgebungen bedeutete, wird fast nur am Beispiel Nordamerikas besprochen; die Deportation Homosexueller im Nationalsozialismus kommt erstaunlicherweise überhaupt nicht vor. Trotz dieser Lücken überblickt Fone einen gewaltigen Zeitraum und gibt detaillierte Einblicke in Quellen verschiedener Länder und Sprachen Westeuropas, des Mittelmeerraums und der USA.
Homo-, Bi- und Transphobie sind nicht halt einfach da, sondern sie haben eine Geschichte. Nicht nur von Hass, Abscheu und Angst erzählt Fone, sondern auch von ihrer Überwindung und dem Kämpfen um Rechte und Anerkennung. Sein Verdienst ist besonders zweierlei: Zum einen trägt er zusammen, was zahlreiche andere Forscher:innen zutage gefördert haben. Zum anderen ist er nah an den historischen Quellen dran, liefert reichhaltig Lektüren von Gesetzestexten, Traktaten, Berichten, Gedichten, Romanen und anderer hochinteressanter Texte. Der Stil ist gut lesbar und die Gliederung so geschickt, dass bei Bedarf auch ein Kapitel ohne den Kontext der anderen gelesen werden könnte. Was sie alle zusammengelesen zeigen, ist nicht eine lineare Entwicklung des Fortschritts, sondern immer wieder die fürchterliche Gleichzeitigkeit von Toleranz und Ignoranz, das Auf und Ab gewonnener und wiederverlorener Errungenschaften, die Bereitschaft, eine Diskriminierung durch Befeuerung einer anderen zu bekämpfen. Besonders furchteinflößend in Zeiten der Pandemie und des Klimawandels ist die Einsicht, wie große Umwälzungen und traumatische Erfahrungen in einer Gesellschaft die Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten gefährden können. Auch darum brauchen wir ein queeres Geschichtsbewusstsein.
StadtgeschichtenVon Lisa M. Müller
Göttingen ist das Paradebeispiel für ein bestimmtes Gefühl von »ah, stimmt, die Person hab ich auch schon öfter in der Turmmensa gesehen« bis zu »wir hatten im zweiten Semester den gleichen Französischkurs bei Madame Bréhinier UND mögen gern Falafel vom Grünen Libanon – das kann kein Zufall sein«. An dieses Gefühl erinnert mich eine meiner Lieblingsserien, die ich hier wärmstens empfehlen möchte: die auf Armistead Maupins gleichnamiger Romanreihe basierende Serie Stadtgeschichten. Auf Netflix sind seit längerem Staffel 1 aus den 1990ern und das Revival aus dem Jahr 2019 abrufbar.
Serien-Info
USA 1993/2019
Idee: Richard Kramer/Lauren Morelli
Mit: Laura Linney, Elliot Page, Olympia Dukakis und anderen
Zeitgeschichtlich behandelt die Serie wichtige Themen der 90er Jahre wie auch unserer Gegenwart: Sowohl HIV bzw. das Sterben an AIDS als auch Kämpfe um die Anerkennung und Gleichberechtigung von queerem Leben kommen vor. Das alles wird auf eine selbstverständliche und angemessene Art erzählt. Die Charaktere werden zu einer Familie, aber auch als Rezipient:innen fühlt man sich ihnen sehr nah. Das Erzähltempo der alten Folgen ist angenehm unaufgedreht und der Stil ist warmherzig in allen Staffeln.
In der Serie mögen manche Que(e)rverbindungen etwas gewollt wirken, die Realität ist aber, gerade für queere Personen, oft genauso vernetzt. In Göttingen ist es üblich, dass neue Bekannte in der Regel verschiedene (Ex)freund:innen, Kommiliton:innen oder Partyflirts bereits kennen. Für queere Personen in Göttingen potenzieren sich diese Zufälle. Unter anderem dadurch, dass es nur wenige Freiräume für queeres Leben gibt. Dafür sind die, die es gibt, sehr schön und wichtig, wie zum Beispiel das kollektiv betriebene Café Kabale. Bis wir da wieder mit gutem Gefühl und kleineren Corona-Sorgen an einer Limo nippen können, schaut die Stadtgeschichten!
Casey Plett: Little FishVon Linus Lanfermann-Baumann
Habt ihr schon mal den ganzen Winter im kanadischen Winnipeg verbracht? Oder euch in die Kultur der Russlandmennonit:innen Süd-Manitobas vertieft? Vielleicht sind unter euren Freundinnen mehrere Transfrauen mittleren Alters? Oder ihr seid zufällig mit dem Alltagsgeschäft der Sexarbeit vertraut? Falls nicht, dann ist Casey Pletts Roman Little Fish eine wunderbare Gelegenheit, sich mit diesen unbekannten Gewässern vertraut zu machen.
Plett, selbst Kanadierin und mennonitische Transfrau, versucht nach eigener Aussage, »wahrhaftige« Geschichten von diesen Welten zu erzählen. Bei einem Besuch der kanadischen McMaster University erzählt sie, dass ihr sehr wohl bewusst sei, wie unbekannt diese Welten den meisten ihrer Leser:innen sein werden. Von denjenigen, auf die das nicht zutrifft, »sind wahrscheinlich die Hälfte meine Freund:innen«, fügt sie lächelnd hinzu. Und dennoch lädt sie ihre Leser:innenschaft ein, sich auf ihre Geschichte einzulassen und das Unvertraute auszuhalten:
Vielleicht versteht man nicht jede Kleinigkeit einer jeden Sache, aber hoffentlich versteht man die dazugehörigen Gefühle der Figuren und was das in dem unmittelbaren Moment bedeutet.
Little Fish ist als Roman in einigen Momenten genauso aufwühlend, wie er insgesamt hoffnungsvoll ist. Suizid, sexuelle Gewalt und Alkoholismus sind verwoben mit Erfahrungen von Güte, Freundschaft und Liebe in vielen Varianten. Zwar ist es bedauerlich, dass Pletts Werk noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, doch ist Little Fish alles andere als schnörkelhaft geschrieben. Wer mittlere Englischkenntnisse besitzt (und für wen zutiefst bestürzende Thematiken kein Ausschlussgrund sind), dem:r verspricht der Roman brutal ehrliche Einsichten in zuvor unbekannte Welten. Nehmt Pletts Einladung an und seid gespannt, wohin sie euch führt.