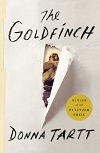Die Vorlesungszeit fordert Studierenden einiges ab. Dicke Wälzer wollen verschlungen werden und Sekundärliteratur diskutiert. Gut, dass es die Semesterferien gibt, in denen Zeit für freie Lektüre ist. Die Redaktion macht drei Versuche, sich von den Leselisten zu lösen.
Lost in Habitus
Von Tanita Kraaz
Jochen Schmidt Gebrauchsanweisung fürs Laufen
Urlaub ist eine Zeit, in der man sich neu erfinden kann. Wir erinnern uns alle an die Simpsons-Folge (Staffel 7, Episode 25), in der die unverbesserliche Lisa im Strandurlaub plötzlich zu den coolen Kids gehörte. Das lag, so meine These, allein an ihren neuen Accessoires: Batik-Shirt, Baseballcap, Badelatschen. Diesen Sommer, so dachte ich Anfang September, mache ich es ihr nach. Es stimmt schon, dass ich nie versucht habe, meinen Proust mit in
Reihe
Pipers Gebrauchsanweisungen sind eh Kult. Den vielen für Länder, Gegenden und Orte folgen schon seit einiger Zeit welche für Tätigkeiten, Hobbies und so weiter (zum Beispiel Felicitas von Lovenbergs Gebrauchsanweisung zum Lesen). Dem Verlag gelingt es immer wieder, renommierte Autor*innen zu gewinnen, die sich solcher Alltäglichkeiten annehmen. Deren persönlicher Zugang und ihr geschulter Blick auf die Gegenstände ermöglichen es den Leser*innen im besten Fall, eine (neue, positivere, beherztere) Beziehung zu den Dingen aufzubauen.
Der Romancier und Übersetzer Jochen Schmidt ist eigentlich bekannt für seine autobiographisch motivierte Auseinandersetzung mit der DDR, ihrem Ende und der Nachwendezeit. Dieser Hintergrund fehlt auch in seiner Gebrauchsanweisung nicht. Durch seine humorvollen Schilderungen des ideologisch vereinnahmten Sportunterrichts in seiner Jugend schafft er es trotzdem, auch DDR-ferne albtraumhafte Erlebnisse der Schulzeit ins Gedächtnis der Leserin zu rufen. Es macht schon Mut, dass er sogar seine eigenen Erfahrungen zugunsten seiner Hobbyläufervita überwindet. Diese und weitere persönliche Ausführungen wie die zu seinen Sportverletzungen (reinste Odysseen der Ärzte-/Physiotherapeut*innen-/Schuhverkäufer*innen-Suche) stehen zum Beispiel in Zusammenspiel mit der wohlrecherchierten Geschichte des Laufens als Sport oder der Geschichte des Laufschuhs bzw. der Diversifizierung der Sneakermarken. Letzteres
Doch Vorsicht ist auch bei der Aneignung dieser Kleinode geboten. Wider Erwarten taugt mein Buch nicht zum Urlaubsaccessoire. Ich war die einzige, die ihre grelle flugzeugeigene Leselampe im Zeitzonen-verrückten Zwielicht anließ. Sicher waren da auch zwei, drei, deren dezent heruntergedimmte eReader zu sehen waren. Auf dem Sitz zwischen mir und meinem Sitznachbarn lag sogar ein von ihm ungelesenes Stadtbüchereibuch ausgestellt; The Handmaid’s Tale zu allem Überfluss! Wir Leser*innen waren trotzdem verloren zwischen denen, die das mäßige Angebot an Filmen wahrnahmen, Smartphone-Spiele spielten oder schliefen. Wir fielen auf – und zwar nicht als die coolen Kids. Es ist mir ja bewusst, dass es maßlos überheblich ist, sich drüber zu beschweren, dass man der eigenen prätentiösen Außenwirkung nicht entkommt. Ich gebe auch zu, dass mein Versuch eher halbherzig war. Wäre mir die Schwierigkeit meines Unterfangens vorher so bewusst gewesen, hätte ich mich diesen Sommer vielleicht trotzdem ein weiteres Mal an der Lektüre der Recherche versucht.
Puh!-litzer Sommerlektüre
Von Mara Becker
Donna Tartt: The Goldfinch
The Secret History, Donna Tartts Debutroman, habe ich innerhalb von drei Tagen verschlungen. Die invertierte Detektivgeschichte – sonst eigentlich gar nicht mein Genre – faszinierte mich mit ihren stark konzipierten Charakteren, der elegant-spitzfindigen Sprache und, natürlich, dem so gut funktionierenden Spannungsbogen. Die Filmadaption von Tartt’s drittem Roman The Goldfinch, für den sie 2014 den Pulitzer Preis erhielt, läuft diesen September in den Kinos an. Grund genug, neben Wassermelone und Handtuch auch den Roman in die Badetasche zu schieben.
Die Autorin versteht sich auf fulminante Einstiege: wo der Erzähler im Erstling den Mord eines seiner besten Freunde beichtet, da überlebt der 13-jährige Theo in The Goldfinch nur knapp einen Bombenanschlag in einem Museum (dessen Hintergründe ihn im Folgenden kaum interessieren werden). Seine Mutter stirbt – und der unter Schock stehende Junge klaut das Gemälde, das sie sich zuletzt gemeinsam angeschaut hatten. Ich verrate wohl nicht zu viel: es handelt sich um The Goldfinch von Fabritius. Es ist die einzige Verbindung, die Theo noch zu seiner Mutter bleibt und wird ihn den gesamten Roman über begleiten. Theo erlebt so einiges: er wird älter, er nimmt Drogen, sein alkoholabhängiger Vater kehrt nach langer Abwesenheit zurück und verschleppt ihn nach Las Vegas, eine Weile verbringt er auch auf der Park Avenue bei den ebenso reichen wie distanzierten Eltern eines Freundes. Eine Ersatz-Vaterfigur in Form des schrulligen, aber umso
Ganz deutlich ist eines: Tartt zeichnet Gut – und sie zeichnet Böse. Graues, Verschwommenes oder gar Unentschiedenes gibt es eigentlich nicht. Wo ist das feinsinnige Plotting hin, das The Secret History auszeichnete? Warum gibt die Autorin sich endlosen Beschreibungen, Benennungen, Deutungen hin, die vollkommen überflüssig sind und den Roman deutlich länger machen, als er sein müsste? Wohin ist der Mut, Leerstellen zu lassen? Tartt liefert düstere, langatmige Monologe, die den Plot kaum vorantreiben, verliert sich in Details und in Harry-Potter-Anspielungen. Denjenigen, die sich durchbeißen und den Roman bis zum Ende lesen, wird eine hübsche und (man ahnt es schon) großzügig ausgeschmückte Reflexion Theos zur Moral, zur Kunst und zur Trauer kredenzt. Ein etwas erschöpfender Summer-Read ist das auf jeden Fall – darüber hinaus aber wenig.
Zwischen Zombiefilm und Kotzanfall
Von Stefan Walfort
Bela B. Felsenheimer: Scharnow
Für Liebhaber*innen stumpfsinnigen Humors ist der Debütroman des Ärzte-Drummers genau das Richtige: es gibt einen Literaturblogger, der mehr onaniert als zu lesen und zu schreiben – zu Filmen, in denen seine Nachbarin mitspielt. Drei Döspaddel überfallen im Adamskostüm den einzigen Supermarkt im Ort, nachdem sie sich dort kurz zuvor mit Fusel eingedeckt haben. Kein Wunder, dass die Kassiererin sie trotz Papiertüten auf den Köpfen problemlos wiedererkennt. Eine Gruppe Verschwörungstheoretiker liegt den lieben langen Tag auf der Pirsch nach Verdächtigem. Ein unschuldiges Hündchen, in dem sie einen feindlichen Agenten wittert, muss als erstes dran glauben; es wird kurzerhand erschossen.
Und dann sind da noch ein Getränkeproduzent, der es einst mit Gülle zu Milliarden gebracht hat und dessen Sprudel Jahre später noch immer den Ruf weghat, nach Fäkalien zu stinken, und sprechende Namen noch und nöcher: ein Gogo-Tänzer, den eine Furunkel am Hintern plagt, hört auf den Namen Märse (ältere, des Plattdeutschen kundige Semester wissen vielleicht, dass so im Münsterland ein Ausdruck für den Allerwertesten lautet). Ein Pauker, der sich an Schülern vergreift, heißt mit Nachnamen ausgerechnet Wenker. Damit den Namenswitz auch wirklich niemand überliest, erklärt die
Damit ist auch schon das Hauptproblem benannt, an dem das Buch neben seiner Überfülle von Zoten krankt: die Perspektivierung. Offenbar meint Bela, er müsse seine Erzählinstanz vieles, was von selbst oder durch Figurenhandeln offensichtlich wird, zusätzlich von außen kommentieren lassen. Auch springt einem hin und wieder ein recht ungelenk zusammengeschusterter Wortlaut ins Gesicht wie in dem Satz: »Das Glück manifestierte sich in dem stickigen Raum in einem rauschenden Fest der Sinne«, wo der doch sehr elegante Ton, den das Verb anschlägt, nicht zur Gesamtatmosphäre passen will. Schließlich wird hier geschildert, wie die eingangs erwähnten Trunkenbolde zwischen Zombiefilm und Kotzanfällen nebst Gedanken an Gruppenmasturbation ihren Raubzug durch die Billkauf-Filiale ausbaldowern. Manifestieren tut sich da jar nüscht. Allenfalls bricht etwas über die Tölpel herein. Meinetwegen das Gefühl von »Glück« – beim Träumen davon, wie sie mit der Beute »ihre Sinne den Göttern Filmriss, Blackout und Koma opfern!« Ungleich größeres Glück dürfte genießen, wer die Büchertische mit Scharnow drauf großräumig zu umgehen weiß, um ja nicht in Versuchung zu geraten. Hieße ich Denis Scheck, so hätte ich das Buch mit Karacho in die Tonne gedonnert.