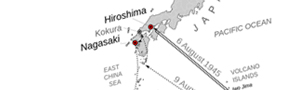Hier wird über Epikur reüssiert und das Ende der Kunst datiert: In dem Essayband Bluescreen des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Mark Greif werden die Dinge des Alltags mittels eines kulturwissenschaftlichen Fernrohrs aus dem Lehnstuhl heraus analysiert, messerscharf und doch mit zweischneidiger Klinge.
Von Malte Gerloff
Stellen wir uns einmal vor, wir würden in die Mensa gehen, zum vereinbarten Treffpunkt erscheint neben den üblichen Verdächtigen jedoch jemand völlig Unbekanntes. Dann, nachdem bei der Essensauswahl das größte Übel eingeschränkt worden und doch nichts weiter als Missmut auf dem Teller liegen geblieben und man sich damit schon auf den Tisch zubewegt hätte und man plötzlich schon in der wohlbekannten Litanei gelandet wäre, ja dann begönne dieser Jemand das Gespräch, begönne, ein Thema aufzuwerfen, welches wir alle kennen: Man horcht auf und hin! – Er redet übers Rappen – klar, das kennen die meisten aus ihrer Jugend – oder verfolgen es noch immer im Fernsehen oder auf einer der vielzähligen Internetplattformen, von denen die bekannteste auch noch später thematisiert werden soll. Er steigert sich – verfällt geradezu in einen Monolog. Erzählt, wie er in der New Yorker U-Bahn stand und Zeilen von Biggie gerappt habe: »If I wasn’t in the rap game / I’d been a key knee deep in the crack game« – und wie lange er dafür gebraucht habe, in diesen für ihn, den Postrocker, anderen Flow hineinzukommen. Seine Ausführungen gewinnen dabei langsam an Tiefenschärfe. Er ist übers Rappen in das Sezieren der amerikanischen Gesellschaftsverhältnisse geraten. Und jetzt erinnerst du dich, sagte nicht zuvor jemand, er hieße Mark Greif und käme aus New York? Ja, klar! Und dann fragte ihn, den Literaturwissenschaftler, jemand, worum es in seinen Essaybänden so gehe.
Doch da dem nicht so ist, sondern dieses Gespräch nie stattgefunden hat, sitzt man zu Hause, liest in Bluescreen, das von Mark Greif geschrieben worden ist, und kann so aus beruhigter Entfernung den Vorteil genießen, alles genauer zu betrachten als dies bei einem Gespräch der Fall wäre, so besteht die Möglichkeit, hin und her zu blättern wie es beliebt. Durch die Ruhe des Leseakts fällt einem nämlich auf, dass die stichhaltigen Argumente der Texte eine zweischneidige Klinge sind, die Mark Greif da zu führen pflegt.
Doch zunächst zum vielgestaltigen Inhalt, der neben dem Versuch des Postrockers, oder wohl eher Ex-Postrockers, Rappen zu lernen, vieles enthält. Man ist fast geneigt zu sagen, er kreist um alles, denn der Inhalt hat Spannweite, geht allumfassend – wie auch sonst? – ins Universale und so ergibt sich fast zwangsläufig der Eindruck, es handele sich hier um einen Universalgelehrten alter Schule, längst vergangener Tage, versehen mit einem Pop-Upgrade. Denn hier wird über Epikur reüssiert, das Ende der Kunst datiert, die Dinge des Alltags mittels eines kulturwissenschaftlichen Fernrohrs aus dem Lehnstuhl heraus analysiert.
Buch-Info

Mark Greif
Bluescreen
Essays
Herausgegeben und aus dem Englischen von Kevin Vennemann
Suhrkamp: Berlin 2011
231 Seiten, 15,00 €
Aber es sind nicht nur die leichteren Tönen der beiläufigen Alltäglichkeit, die Greif erklingen lässt: Er nimmt sich auch durchaus heiklen Themen wie die immer weiter durchgreifende Sexualisierung von Kindheit und Jugend an, die er kritisch an den vom Mickey-Mouse-Club erzeugten Pop-Ikonen wie Britney Spears oder Christina Aguilera und deren Auftreten im Essay »Im Hochsommer der Sexkinder« durchdekliniert. Oder er spricht sich kurzerhand für eine Deckelung von Gehältern, ja für eine Gehaltobergrenze aus, wenn er eine »Gesetzgebung aus dem Bauch«, wie er es nennt, beschreibt – die geradezu ekelhaft sozialistisch scheint, wie Kurt Vonnegut mit Ironie und einem verkniffenen Lächeln sagen würde.
Dabei ist es aber gerade nicht nur die Gesellschaftskritik, die im Vordergrund steht, sondern es ist das zentrale Anliegen des Bandes, den Stellenwert der Medien im heutigen Leben zu dokumentieren, aufzuzeigen, wie wichtig diese in der Biographie jedes einzelnen geworden. Wie sehr diese in den Mittelpunkt gerückt sind, wird schon anfangs deutlich, wenn er sich fragt, wie es der Mann wissen könne, wie er den allerersten Geschlechtsakt mit einer Frau vollziehen könne, so zieht Greif, der sich bei dieser ersten Ausübung über den Erfolg der Operation nicht sicher ist, die Blaue Lagune als Beispiel für eine klassische Insellage heran und fragt fast unschuldig, ob man sich an diesen Film erinnere.
Doch um die Zentralität der Medien und den kolossalen Wandel mit Eintritt in das digitale Zeitalter aufzuzeigen, verweist er auf ein anderes und dennoch wohlbekanntes Beispiel: YouTube. Und dort wählt er auch noch das meistgesehene Video. Absolut gewollter Mainstream. Bei diesem Vorhaben zeigt sich ein Vorgehen, das immer bedacht an der Popoberfläche klebt, um so die größtmögliche Nachvollziehbarkeit für jeden Zeitgenossen zu erreichen, ein Vorgehen, dem Greif in diesem Essay-Band treu verhaftet bleibt. Und welches zu dem Ergebnis kommt, dass die meist gesehenen Videos auf YouTube Talentshows seien, was wohl aber nur die amerikanische Version betrifft. Dennoch lässt diese Beurteilung ihn deutlich in die Nähe des eine Zeit lang allgegenwärtigen Slavoj Zizeks rücken. Man war ja auch zusammen im Occupy-Camp.
Doch kommen wir vom Schwelgen der positiven Seite, doch nun auch zur anderen Seite der zweischneidige Klinge. So vollendet diese Essays zum einen, so sind sie zum anderen aber auch unvollständig, fehlt gar zuweilen der Gang unter die Popoberfläche. Nimmt man sich dabei aber zunächst des Raps an, wird in aller Kürze deutlich, dass Greif die Pionierzeit völlig außer Acht lässt, es fehlen also Afrika Bambaataa oder Melle Mel und auch andere wie RUN DMC oder NWA kommen in ihrer Bedeutung kaum angemessen zum Zug. Doch selbst wenn man der Meinung ist, es handele sich hier ja nur um eine Bestandsaufnahme eines gewissen Zeitraums, so fehlen doch auch gerade andere Größen der Zeit, die nicht ins Argumentationsschema des entweder Crack oder Rap passen, so zum Beispiel die Beastie Boys. Und eigentlich wird dies auch schon mithin im Vorwort deutlich:
»Wenn ich mich frage, ob unsere Zivilisation an ihr Ende gelangen kann – und damit meine ich ihre Vollendung, nicht ihre Vernichtung – dann finde ich es hilfreich zu berücksichtigen, dass der begrenzte kulturelle Bereich der Kunst schon zu meinen Lebzeiten tatsächlich an ein Ende gelangt ist, woran sich damals aber niemand groß zu stören schien.«
So klug und kunstreich der Satz gewoben und der Gedanke vollbracht ist, so eindeutig unterschlägt er, dass es schon das Hegelsche Diktum vom Ende der Kunst gegeben hat – das Ende der Kunst besteht also fast schon seit über 200 Jahren, wodurch es allerdings auch nicht richtiger wird, wenn man es auf die 1980er Jahre bezieht. Und vielleicht kommt daher Greifs Unbehagen, welches er im Horizont der Aufklärung fühlt, bevor er auf Orwells 1984er Dystopie – und in Sonderheit deren Verwirklichung – zu sprechen kommt:
»Die exzentrische Umdrehung des Globus prägen dem Gewebe der Ewigkeit einen Zwischenbericht zum zivilisatorischen Fortschritt auf. Nur wer sehr schlechte Augen hat, könnte annehmen, dieser Bericht sei das letzte Wort. Wir wollten Paläste des Geistes errichten oder zumindest eine Stadt auf einem Hügel. Stattdessen haben wir die westliche Welt in ein gigantisches Wartezimmer verwandelt, in dem es bunte Magazine gibt und einen Fernseher, der unablässig dröhnt. Wenn der Doktor uns zur Untersuchung hereinruft, drückt er uns ein paar Tabletten in die Hand und schickt uns gleich wieder hinaus, um ein bisschen länger zu warten. Wir werden die schlechten Nachrichten später erfahren. Wann? Sehr viel später.«
Da also Greif soweit geht, den Medien des digitalen Zeitalters eine Mitschuld an der Crux des Jetzt zu geben, verwundert es kaum, dass er anfangs feststellt, dass das Blau des Computerbildschirms, inzwischen auch Himmel genannten werden könne, so endigt er mit derselben Metapher, nachdem er unter Verwendung eines Zitats aus dem Jahre 1917, welches in der Technik die Hoffnung einer neuen Belebung des Menschengeschlechts zum Ausdruck bringt, eine Metapher, die auch hier das Schlusswort bilden soll und die Greif offensichtlich kritisch sieht:
»Früher leuchteten unsere Gesichter rot in der Hitze der lodernden Flammen. Heute werden wir blau angeleuchtet: blau das Kinn, blau der Hals, blau die Pupillen. Das Blau unserer Bildschirme. Es muss einen anderen Weg geben, das Neue zu sehen.«
Oder: Ist die digitale Revolution das Utopia, das wir wollen? Oder bringt sie uns diesem überhaupt näher?