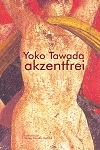Yoko Tawadas Art zu schreiben verzaubert. In ihrem neuen Buch akzentfrei tut sie das gleich vierzehnmal in Essays, die sich mit Themen wie Joghurt, den Tücken der Sprache oder der Philosophie der Nahrungsaufnahme beschäftigen. Das klingt wie ein bunt gemischter Salat, ist aber um einiges unterhaltsamer als das Gartengemüse. Und man ist hinterher nicht im Mindesten frustriert, weil man lieber ein Stückchen Schokolade hätte. Denn der Salat ist in diesem Fall mindestens genauso schmackhaft.
Von Joana Kolbach
Yoko Tawada kann nicht nur poetische Romane wie Ein Balkonplatz für flüchtige Abende schreiben, sondern auch unterhaltsame Essays. Letztere erschienen zusammengefasst in ihrem neuen Buch akzentfrei. Der Band ist in die drei großen Kapitel In einem neuen Land, Nicht vergangen und Französischer Nachtisch unterteilt, worunter sich wiederum die Essays einreihen. Diese sind kurz und prägnant – mit wenigen Worten ist alles gesagt.
Die Texte tragen Titel wie Transsibirische Rosen oder Namida und handeln von einem Besuch auf Sylt, der zu Überlegungen zu Übersetzungen und Wortursprüngen führt oder der Funktion von Tränen in der japanischen Literatur. Wir lesen etwas über die Zeit und Bushaltestellen, Fukushima, die Halbwertzeit von Trauer, Vegetarismus oder Mythen. Diese Kombinationen wirken spontan und entfalten sich zu einem dichten Geflecht von Gedanken, denen zu folgen Freude bereitet.
Aber vor allem geht es um Sprache und wie sie formbar, wie sie wahrnehmbar ist. Der eine versteht das eine, der nächste wieder etwas ganz anderes in diesem oder jenem Ausdruck. Tawada spielt mit der Semantik und macht sich dabei die Mehrdeutigkeiten von Wörtern und ihre Etymologie zunutze, wenn sie diese im Deutschen betrachtet oder dem Japanischen gegenüberstellt und beobachtet, wie sich die Wörter dabei verändern: »Es gibt Wörter, die vergessen werden, aber es gibt auch Wörter, die neu geboren werden.«
Eine philosophische Ansicht, mit der Tawada das Wort gekonnt in Szene setzt. Was sie tut in diesem schmalen Bändchen mit Essays aus dem Leben, das ist Worte in Kunstform oder Kunst in Wortform zu erschaffen. Yoko Tawada hat das Talent, den Blick auf Dinge zu lenken, die man selbst als völlig selbstverständlich hinnimmt, zu hinterfragen, nachzubohren. Und es schimmert Humor zwischen den Zeilen durch, wenn sie mit viel Wortspiel in Setzmilch über Joghurt schreibt, woher er kommt und das Brimborium, das die Menschheit um den Verzehr desselben betreibt: »Ich möchte zuerst über Kultur sprechen, und zwar über eine spezifische Form von Kultur, nämlich die Joghurtkultur.«
Das ist ziemlich unterhaltsam und zeigt auch auf, wie viel Lärm man selbst um die einfachsten Dinge machen kann. Oder dass man eben nicht alles als allgemeingültig betrachten sollte, das tut auch Tawada in keinem ihrer Essays, die ziemlich vielschichtig sind. Man kann sie chronologisch lesen oder bunt durcheinander, denn sie sind abgeschlossene Einheiten.
Definitiv Potenzial zum Lieblings-Essay hat jener mit dem Titel Namida. Es geht um Tränen und deren Funktion in der japanischen Literatur. Pointe ist, dass Männer aus einem bestimmten Grund weinen, Frauen grundlos und nur wegen der Hormone.
Niemand weiß, ob die Mädchen wirklich öfter weinen als die Jungen, aber der Unterschied besteht dem Klischee nach darin, dass die Mädchen aus unwichtigen Gründen beziehungsweise ganz ohne Grund weinen oder selber nicht wissen, warum sie weinen.
Dass dieses Klischee nur ein Klischee ist, ist unbestreitbar. Aber dass Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen weinen nicht. Ausgangspunkt des Essays ist ein mittelalterlicher japanischer Text, in dem ein Dichter einige Zeilen schreibt, die seine Reisegefährten so sehr berühren, dass sie weinen und den Reiseproviant – aus Reis bestehend – damit aufweichen. Danach unternimmt die Autorin eine Reise durch die Zeit und beschäftigt sich mit weinenden Robotern, Tränen verdrückenden Sportlern und Sportlerinnen und landet schließlich beim modernen weinenden Menschen. Diese Analyse ist mit Geschichten gespickt, die ebenso unterhaltsam wie treffend zu lesen sind. Denn vom Unterschied zwischen Mann und Frau hat man in allen möglichen Formen schon gehört und wird dessen langsam müde. Doch Tawada fügt dieser Debatte eine Nuance hinzu, die zwar von einer Deutungs-Schablone ausgeht, diese aber so aufbereitet, dass man eben nicht gelangweilt ist.
Zum Ende hin werden die Texte ernster, analytischer und weniger verspielt. Dadurch geht ein wenig die Leichtfüßigkeit verloren, mit der der Klappentext des schmalen Bändchens wirbt. Ein Minuspunkt ist das allerdings nicht. Dadurch ist für jeden etwas dabei – sowohl für den Abends-vor-dem-Schlafengehen-Leser, der auf unterhaltsame Lektüre Wert legt, als auch für die anspruchsvolle Sessel-im-Kaminzimmer-Leserin, die nach Stoff zum Nachdenken sucht.
Um auf die Eingangsmetapher zurückzukommen: Der Salat entpuppt sich zwar nicht als verstecktes, wohlgefälliges und unkompliziertes Stück Schokolade, aber Freude hat man an den Texten trotzdem, denn sie enthüllen mehr, als das Grünzeug auf den ersten Blick zu bieten hat. Ein zweiter Blick hinter die Fassaden lohnt sich, denn man denkt noch lange nach der Lektüre über das nach, was man gerade gelesen hat. Und das macht ein gutes Buch aus.