Unser Onkel, so lautet der Titel des 2008 erschienenen Romans von Arnon Grünberg wörtlich übersetzt. Die Romane des vielfach prämierten Bestsellerautors, Journalisten und Bloggers erzählen immer wieder Geschichten über Familie als Krisenherd, über Menschen, die ausbrechen und in Schieflage geraten wollen, um für kurze Augenblicke Geborgenheit und Freiheit zu spüren – und schließlich an ihrem Lebenshunger zu scheitern.
In Onze Oom entführt Grünberg seine Leser nach Südamerika. Krieg wird in diesem Roman nicht nur zuhause, in der lädierten Kleinfamilie, geführt; im Kriegszustand ist die gesamte fiktive Welt. Beim Göttinger Literaturherbst unterhielten sich Janet Boatin und Moritz Scheper mit Arnon Grunberg über die kürzlich im Diogenes Verlag erschienene, deutsche Übersetzung: Mitgenommen.
MS: Herzlich Willkommen, Arnon Grünberg. Eine lockere Frage zum Einstieg. Uns ist aufgefallen, dass Ihr Name auf den deutschen Buchdeckeln minimal anders geschrieben wird als in den Niederlanden. Was hat es damit auf sich?
AG: Stimmt. Auf dem deutschen Buchdeckel steht Grünberg mit einem Umlaut, überall anders ist der Umlaut verschwunden. In meinem Reisepass steht noch immer der Umlaut. Als ich auf dem Gymnasium war, habe ich ihn einmal weggeworfen und dachte, der Umlaut wäre damit für immer weg.
Mein erstes Buch habe ich in Holland ohne Umlaut veröffentlicht. Als das Buch dann von Diogenes gekauft worden ist, hat mich der Verleger angerufen und gesagt: Grunberg? Heißen Sie wirklich so? Ich antwortete: Naja, in Wirklichkeit war mal ein Umlaut da. Er hat dann vorgeschlagen: Im deutschsprachigen Raum ist es fremd, Ihren Namen so zu verändern. Können wir den Umlaut deshalb nicht wieder auf Ihren Namen setzen. Ist ja nur in Deutschland, das merkt keiner! Ich stimmte zu. So kam diese etwas schizophrene Situation zustande, die ich eigentlich auch sehr mag.
MS: Schizophren inwiefern? Weil Sie eine doppelte Identität besitzen: Der Niederländer mit deutschem Hintergrund.
AG: Genau. Meine Eltern sind beide in Berlin geboren, waren mal deutsch. Dass ich hier Grünberg heiße, dort Grunberg, tut dieser Situation, diesem Fremden irgendwie Recht. Aber es ist auch manchmal schwierig. Mittlerweile fangen auch Holländer an, meinen Namen mit Umlaut zu schreiben und dann muss ich sagen: Nein, in Holland ohne Umlaut, aber wenn Sie die Grenze überschreiten, kommt der Umlaut hinzu.
JB: Sie haben also doch Grenzen? Das ist schön. Aber machen wir Ihre Identität noch etwas brisanter oder doppelbödiger. Bisher sind Ihre Prosawerke relativ zeitnah ins Deutsche übersetzt worden. Es klafft jedoch eine Lücke. Warum liegt Ihr großer jüdischer Roman De Joodse Messias (2004) noch nicht in deutscher Sprache vor?
AG: Rainer Kersten ist mit seiner Übersetzung fertig, aber Diogenes hat gezögert, dieses Buch in Deutschland zu veröffentlichen. Ich will nicht für Diogenes sprechen. Ich weiß allerdings, dass jemand im Verlag Angst davor hat und dachte, dass das Buch in Deutschland falsche Reaktionen hervorrufen kann. Ich habe mich zwar dagegen gewehrt und erklärt, dass man keine Angst zu haben braucht, weil auch die Deutschen etwas gewöhnt sind, wenn es um Literatur geht.
Wie Sie wissen, hieß eines meiner Bücher im Original Die Geschichte meiner Kahlheit; ins Deutsche übersetzt heißt es, apropos Namensänderungen: Amour fou. Der deutsche Verleger, den ich im Übrigen sehr schätze, sagte damals: Kahlheit ist in Deutschland ein Tabu. Wenn es um Kahlheit geht, denken die Leute, es sei ein Sachbuch, und dann kauft es keiner. Es gibt also anscheinend Befindlichkeiten in Deutschland, die ich nicht so gut kenne. Ich hoffe jedoch, dass das Buch bald kommt.
MS: Ich komme noch einmal auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Übersetzer, Rainer Kersten, zurück. Viele niederländische Autoren sind ja genau an dieser Hürde gescheitert und nie in Deutschland angekommen. Gerard Reve beispielsweise, einer der größten Nachkriegsautoren der Niederlande, dessen Werke nie akkurat übersetzt werden konnten. Oder Hermanns, nahezu unbekannt in Deutschland. Bei Ihnen ist es anders, was eventuell an der Übersetzung liegen mag. Uns würde interessieren, wie diese Zusammenarbeit mit Rainer Kersten genau abläuft. Ob Sie sich in den Übersetzungen wiederfinden und inwiefern Sie bei Änderungen, beispielsweise der Titel, mit einbezogen werden?
AG: Rainer Kersten hat all meine deutschen Bücher übersetzt. Ich habe ja viele Übersetzer. Rainer Kersten ist ein Übersetzer, der sehr viele Fragen stellt. Wenn er an einer Übersetzung arbeitet, bekomme ich fast täglich eMails. Und seine Fragen gehen durchaus weit. Ich dachte einmal sogar, dass er heimlich eine Biographie über mich schreibt, denn manche dieser Fragen waren sehr, sehr privat. Aber er sagte, er bräuchte das, um sich besser in die Romane zu versetzen. Ich habe dann immer geantwortet.
Aber ich muss auch dazu sagen, Rainer Kersten arbeitet sehr präzise. Er findet fast immer kleine Fehler im Original. Wenn er mit seiner Übersetzung fertig ist, weiß ich, jetzt ist das Original fehlerfrei und in der nächsten Auflage in Holland baue ich dann die Änderungen ein. Am Ende lese ich noch einmal mit.
Und zum Titel: Beim Titel stimmt nicht nur der Übersetzer, sondern auch immer der Verlag mit. Rainer Kersten erklärte in Bezug auf Mitgenommen, dass ›Unser Onkel‹ im Deutschen nicht wirken würde. Der Titel verweist ja auf El Tío, den Gott in den bolivianischen Minen. In Holland hat dies wohl miträsoniert, in Deutschland anscheinend nicht. Und so hat er erklärt, warum Mitgenommen ein guter Titel ist, dem ich dann auch zustimmte. Ich lese also alles mit und es ist eine ziemlich enge Zusammenarbeit. […]
Das Problem ist: Ich schreibe zuviel. Zumindest dem deutschen Verleger nach. Und obwohl im deutschsprachigen Raum die meisten Übersetzungen vorliegen, will Diogenes nicht zwei Bücher von mir in einem Jahr herausbringen. Bislang sind ja auch meine Sachbücher nicht übersetzt worden. Aber Herr Keel, der Verleger, hat mir versprochen, dass er einmal mein Gesamtwerk verlegen wird. Bevor ich sterbe. Das kann noch dauern, aber irgendwann kommt es.
JB: Seit 2000 veröffentlichen Sie unter dem Pseudonym Marek van der Jagt Romane und Essays. Was waren Ihre Beweggründe, unter Pseudonym aufzutreten? Nur das Spiel mit dem Literaturbetrieb? Und warum hielten Sie diese Maske aufrecht, obwohl Sie 2002 den Schleier lüfteten und man seitdem weiß, dass Sie dahinter stecken?
AG: Am Anfang gab es eigentlich einen ganz praktischen Grund. Ich schreibe seit 1994, seit mein erstes Buch in Holland publiziert wurde, auch für eine Zeitung. Der Redakteur wechselte damals seinen Beruf und wurde Verleger. Wir haben immer nett zusammengearbeitet, aber ich wollte meinen eigenen Verleger zu diesem Zeitpunkt nicht verlassen. Und dann dachte ich: Ich publiziere unter einem anderen Namen ein Buch. So muss niemand eifersüchtig sein oder das Gefühl haben, er hat mich verlassen. Und ich dachte weiter: Dass es doch irgendwie spannend ist, zu beobachten, wie Leute reagieren, wenn sie nicht wissen, dass das Buch von mir ist. Das Projekt wurde dann immer größer.
Irgendwann ist es allerdings schwierig geworden. Denn ich habe ja die Biographie von Marek van der Jagt erfunden: Er ist Holländer, seine Mutter Österreicherin, er ist geboren in Wien und studierte Philosophie, ohne einen Abschluss zu machen. Dann bekam ich für das erste Buch, Amour fou auf Deutsch, einen Preis für den besten Debütroman, den ich allerdings schon für mein eigenes Debüt Blauer Montag erhalten hatte. Anfangs hatte ja kein Journalist recherchiert, wer Marek van der Jagt ist, aber dann fingen Leute an zu recherchieren. Das war eigentlich mein Pech.
Und der Grund, warum der Name bis heute auf den Buchumschlägen steht, ist eigentlich mit der Sache ›Grunberg mit Umlaut‹ vergleichbar. Ich finde, wenn einmal Marek van der Jagt draufsteht, kann man nicht mehr sagen, dass doch jetzt jeder oder fast jeder weiß, es ist Grunberg, also machen wir Grunberg auf den Umschlag!
MS: Sie waren für den NRC als embedded journalist in Afghanistan und Irak. In Deutschland wurde während des zweiten Irakkriegs sehr kritisch über diese Form von Journalismus diskutiert. Schildern Sie doch bitte Ihre Erfahrungen mit dieser besonderen Form der Berichterstattung.
AG: Ich halte nicht alle Kritikpunkte für gerechtfertigt, aber viele sind zu Recht. Man sieht das Problem, den Krieg nur von einer Seite. Deshalb war ich im Irak auch ohne Armee, allein. Zwar braucht man dort als Ausländer noch immer aufgrund der gefährlichen Zustände einen Bodyguard und ist insofern auch abhängig, irgendwie embedded. Ich verstehe die Kritik gut, aber es gibt auch große Unterschiede des Abhängigkeitsumstands, je nachdem, wo man embedded ist.
Als embedded journalist in der holländischen Armee zum Beispiel muss man alle geschriebenen Texte erst einem Presseoffizier vorzeigen. Da fühlt man sich wie ein Schüler, der dem Lehrer seine Hausaufgaben gibt. Wenn man hingegen in die US-amerikanische Armee ›eingedrungen‹ ist und man an einen Offizier gerät, der einem wohlgesinnt ist, dann ist man völlig frei. Niemand fragt nach, was man schreibt, wie lange man bleibt. Ich hatte zum Beispiel im Irak, als ich bei den Amis war, das Gefühl, ich hätte so lange bleiben können, wie ich wollte. Die US-amerikanische Armee ist dezentralisierter. Die Kontrolle darüber, was man schreiben darf, geht nicht von einer Stelle, von Den Haag oder einem Offizier, aus. Und sie denken auch zu Recht: Was kümmert’s uns, was ein Holländer über uns schreibt. Sie sind viel zugänglicher, obwohl man es eher andersherum erwartet.
Die Kritik an der Form des embedded journalism ist also nicht ganz zu Unrecht. Aber wenn man die Wahl hat zwischen: berichten oder nicht berichten, dann sollte man berichten, auch unter diesen Umständen. In Afghanistan, wo die Lage ja immer noch sehr schwierig ist, geben, soviel ich weiß, die Taliban Journalisten aus dem Westen bislang noch nicht die Möglichkeit, embedded mitzugehen.
MS: Entgegen dem Konzept der eingebetteten Berichterstattung haben Sie aber einen kleinen Skandal ausgelöst.
AG: …Jetzt müssen Sie meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen…
MS: Ich spiele darauf an, dass Sie eine Militäroffensive in Ihrem Blog ausgeplaudert haben.
AG: Stimmt. Man hört ja viel. Ich schreibe ja nicht nur für die Zeitung. Da gab es im Herbst 2007 eine Offensive. Es war mir erzählt worden, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt. Und ich dachte: Das kann ich jetzt schreiben. Die Leute wissen ja, weshalb ich da bin. Ich schrieb dann in meinem Blog darüber. Anscheinend wusste aber niemand davon. Jemand vom Verteidigungsministerium in Den Haag hat mich daraufhin angerufen: Ich müsste den Eintrag, jetzt, in diesem Moment, von meiner Homepage streichen. Denn die NATO hatte zugeben müssen, dass die Offensive bereits begonnen hatte, obwohl sie es erst zwei Tage später offiziell machen wollte. Ich fühlte mich in dem Moment, was sich ein Romanschriftsteller fast nie fühlt, sehr wichtig, weil das, was ich schreibe, sogar die NATO beeinflusst. Das war ein ganz kleiner Skandal.
Ich habe auch mal einen holländischen General in Kabul interviewt. Daraufhin meinte ein Presseoffizier, dass das, was er gesagt hat, schlecht für seine Karriere sei, und wollte das Interview zensieren. Ich erwiderte, dass ich nicht mit einem Soldaten, sondern einem General gesprochen habe, der wusste, was er sagt. Und dass ich mich nicht für seine Karriere verantwortlich fühle. Er wollte es so sagen, wie er es gesagt hat. Ich halte es für meine Verantwortung, es so aufzuschreiben. In einem kleinen Land wie Holland gibt es immer wieder Druck, die Berichterstattung zu monopolisieren und in gewisse Bahnen zu führen. Dagegen muss man sich wehren.
JB: In der Vorbereitung auf diesen Abend ist mir bei der Lektüre von Rezensionen, zumindest aus dem deutschsprachigen Raum, etwas aufgefallen: Von männlichen Kritikern werden Ihre Romane vorwiegend positiv besprochen, bei Rezensentinnen kommen Sie hingegen nicht so gut weg. Wiederholt wird kritisiert, das Innenleben Ihrer Figuren, besonders der Frauenfiguren, sei unprofiliert, sogar oberflächlich. Daher stellte sich mir die Frage: Meinen Sie, dass Sie männliche Romane schreiben?
AG: Nein. Zuerst muss man sagen: Kein Romanschriftsteller in Europa und auch in den USA kann behaupten, dass er männliche Romane schreibt. Denn Tatsache ist, dass Romane fast nur oder meistens von Frauen gelesen werden. Ich habe nur die Zahlen aus Holland, da bilden Frauen zwischen 70-80% der gesamten Leserschaft von belletristischen Romanen. Ich treffe sehr viele Männer, die sagen, sie läsen viel, aber keine Romane.
Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich für Männer schreibe. Und teile auch, wie Sie sich vorstellen können, nicht die Meinung der weiblichen Rezensenten, von denen Sie sprachen, wonach meine Frauenfiguren nicht profiliert seien. Ich finde es eine interessante Untersuchung zu sehen, ob meine Romane auch in Holland so rezensiert werden. Ich glaube nicht. Die Antwort auf Ihre Frage ist also: Nein, ich schreibe auch für Frauen, meistens für Frauen. (Lachen im Publikum)
JB: Oder anders herum gefragt: Sind Ihre Romane männlich?
AG: Was ist ein männlicher Roman? Wenn Sie diese Frage einer Schriftstellerin gestellt hätten, hätte sie guten Grund, sauer zu werden. Gestern zum Beispiel habe ich in Ravensburg gelesen. In Mitgenommen geht es ja um Krieg. Bei der Lesung waren 90% Frauen anwesend. Zwei, drei Frauen hatten ihre Männer mitgebracht, die dann eingeschlafen sind. Nach der Lesung kam eine Frau zu mir und meinte: Die Lesung war sehr nett. Aber diese Krieggeschichte ist nichts für mich. Ich warte wieder auf einen Roman, in dem es um Beziehungen geht.
JB: Stereotyp!
AG: Stereotyp. Aber aus der Wirklichkeit geklaut. Also, die Antwort auf Ihre Frage ist kurzum: Nein.
JB: Find ich großartig.
MS: Zwei Verfilmungen Ihrer Romane stehen an. Eine Verfilmung von Tirza läuft in diesem Herbst in den niederländischen Kinos an und Amour fou ist auch in der Mache.
AG: John Malkovich will es verfilmen. Aber beim Film ist man immer vom Geld abhängig. Seit Jahren will er es machen und wartet noch immer auf Geld. Ich habe keine Ahnung, wie weit er ist. Es gibt ja Leute, die meinen, das Höchste, was ein Schriftsteller erreichen kann, sei die Verfilmung seiner Arbeit. Irgendwie finde ich das blöd. Denn ich schreibe ja Romane. Ich freue mich zwar, wenn Andere daraus einen Film machen wollen und der Film gelingt. Aber wenn Tirza zum Beispiel anläuft, empfinde ich es nicht als meinen Film.
Für mich ist eine Verfilmung auch nicht das Höchste, obwohl ich gerne ins Kino gehe. Ich finde, ein Schriftsteller sollte da souverän sein. Ein Film ist etwas Eigenständiges. Ich schreibe Romane, die nicht nur Vorlage für etwas Anderes sind. […] Man hat mich auch gefragt, ob ich das Drehbuch schreiben wollte, aber ich lehnte ab. Nein, ich habe schon den Roman geschrieben und bin mit diesem Stoff fertig. Ich bin keine Orange, aus der man Orangensaft pressen kann.
MS: Nein. Eine Orange sind Sie sicherlich nicht.
Buch
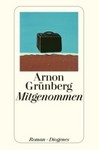
Arnon Grünberg
Mitgenommen
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Zürich: Diogenes 2010
752 Seiten, 22,90€
Bio
Arnon Grunberg, Jahrgang 1971, ist zugleich Wunderkind und enfant terrible des niederländischen Literaturbetriebs. Der Wahl-New Yorker hat bisher 44 Bücher und noch mehr Reportagen veröffentlicht, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und gilt seit dem Ableben Harry Mulischs als bedeutendster Schriftsteller unseres Nachbarlandes.AG: Ich habe viel Mitleid mit den Figuren. Ich glaube, sonst kann man sich auch nicht so lange mit den Figuren beschäftigen. Selbst mit denjenigen, die vielleicht nicht so sympathisch sind, habe ich oft auch Mitleid.
MS: In einer ersten Version sollte der Roman ausschließlich von Lina handeln. Warum genau haben Sie die Figur des Majors hinzugenommen?
AG: Ich habe angefangen, den Roman aus Linas Sicht zu erzählen. Ich wollte über Adoption schreiben und darüber, was in Argentinien oft geschehen ist: dass Kinder adoptiert wurden von Offizieren, die an Ermordungen ihrer Eltern beteiligt waren oder die Eltern eigenhändig getötet hatten. Die Geschichte wollte ich aus der Sicht des Kindes schreiben. Aber irgendwie fehlte da etwas. Ich hatte schon zwei Kapitel, aber irgendetwas stimmte nicht meinem Gefühl nach. Ich dachte: Ich muss eher anfangen; beim Mord der Eltern. Und so ist der Major zu mir gekommen, kann man sagen. Ich habe dann das, was ich bereits geschrieben hatte, weggeworfen und erneut begonnen. Der Major ist dann immer größer geworden.
JB: Der Roman nimmt ab dem Zeitpunkt, ab dem wir Lina begleiten, deutlich Fahrt auf. Es wird schneller und summarischer erzählt, viele Jahre werden übersprungen, es passiert überhaupt viel mehr auf komprimierten Raum. Darüber hinaus fühlt man sich in vielen Textstellen an unterschiedliche realhistorische Ereignisse erinnert. Das Geschehen findet sozusagen in verschiedenen Zeiten statt. Da stehen z.B. Passagen, die an gegenwärtige Entwicklungen des internationalen Terrors angelehnt sind, neben solchen, die mich als deutsche Leserin eher an Geschichten wie die der RAF in den 1970er und 80er Jahren erinnerten. Meine Frage ist ganz allgemein gestellt: In welcher Zeit spielt Ihr Roman?
AG: Ich habe bewusst das Land, wo die Geschichte spielt, nicht genannt. Ich habe gerade schon von Argentinien gesprochen und Sie erwähnten den Terrorismus. Ich habe auch viel in Peru recherchiert, wo es zwei wichtige Guerillaorganisationen gab: den Leuchtenden Pfad und die MRTA. Ich würde also sagen, es spielt in der Zeit, in der es diese Guerillagruppen in Südamerika gab. Jetzt ist ja eigentlich nur noch die FARC in Kolumbien aktiv, und die macht andere Sachen. Ungefähr Anfang der 1990er, Ende der 80er Jahre.
Obwohl es mir nicht um diese Art Realismus ging. Ich wollte, bevor ich diesen Roman über Irak und Afghanistan anfing, auf keinen Fall eine Diskussion darüber: was stimmt und was nicht, was ist realistisch, so geht es in dieser Armee nicht zu, diese Waffen werden nicht gebraucht usw. Deshalb war es mir in diesem Roman auch nie so wichtig, das Geschehen konkret zeitlich festsetzen zu können. Für mich war nur wichtig, wie alt Lina ist.
JB: Ja, ich sagte ja auch, man fühlt sich an diese Zeiten erinnert und es sind immer wieder kleine Versatzstücke, die man wiederzuerkennen glaubt. Geht es Ihnen also auch um so etwas wie Übertragbarkeit?
AG: Ja, zum einen Übertragbarkeit, zum anderen Ähnlichkeiten. Sie hatten die RAF erwähnt, die vergleichbar ist mit den politischen Organisationen in Peru, die sich radikalisierten. Sie begannen mit Gewalt, der Staat reagierte wiederum mit Gegengewalt. Das sind Zyklen, aus denen man nicht leicht herauskommt. Lange vor dem 11. September 2001 gab es da bereits Selbstmordattentäter. Damals war schon alles da, aber weit weg und fühlte sich deshalb nicht so nah an.
JB: Auf eine perfide Art und Weise wiederholt sich also Geschichte, zumindest bestimmte Zusammenhänge.
AG: Absolut.
[…]
MS: Was macht den Raum Südamerika so interessant für Sie? Vielleicht weil in Südamerika noch Konflikte verhandelt werden, die in Europa seit den 1970er Jahren keine Rolle mehr spielen.
AG: … oder auf eine andere Art und Weise wieder zurückkommen. Genau, gerade deshalb ist Südamerika so interessant. Wir in Europa hatten das Gefühl, dass mit Beginn der 80er Jahre alle Konflikte gelöst waren. Ich würde sagen, dass die Geschichte sich anders bewegt hat, als wir damals gedacht haben.
JB: Ihre Figuren stoßen immer wieder an kommunikative Grenzen. Vorstellungen von Zwischenmenschlichkeit werden in ihnen extrem strapaziert und auf die Probe gestellt. Das reicht von inzestuösen Verwicklungen zwischen Vätern und Töchtern bis zu Aussagen, dass eigentlich nur Sex die Menschen verbindet. Explizit dargestellte Sexszenen spielen folglich auch in Ihren Romanen eine wichtige Rolle und haben eine Funktion. In Mitgenommen heißt es an einer Stelle: »Letztlich ist es der Staat, der uns vom Tier unterscheidet« (424). Gibt es Ihrer Ansicht nach so etwa wie einen Kern des Menschseins? Etwas, was uns verbindet? Und welche Antworten gibt Mitgenommen?
AG: Das sind viele Fragen in einer. Sie fingen an mit den Grenzen der Kommunikation: Ich glaube, dass das nicht nur meine Figuren betrifft. Was sicherlich alle nachvollziehen können, ist, dass es Grenzen gibt, was gesagt und vom anderen verstanden werden kann. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich würde fast sagen, dass diese Grenzen der Kommunikation eine Tatsache sind, worüber man aber auch diskutieren kann.
Zum Thema Menschlichkeit finde ich es interessant, eine Figur wie den Major auszusuchen, der für viele und auch für mich ein Unmensch ist und Unmenschliches tut, was noch menschlich an ihm ist. Es hat ja nur Sinn über Menschlichkeit zu reden, wenn es geteilte Menschlichkeit ist. Wenn man also nicht nur sagt, dass die Bürger dieses Staates menschlich sind, ihre Feinde aber nicht. Eine solche Untersuchung könnte eine – das Wort ›Aufgabe‹ finde ich zu groß, denn Literatur kann alles, muss alles und muss nichts von mir aus – eine solche Untersuchung könnte eine Aufgabe der Literatur sein. Gerade in einem Roman, mehr noch als in einem Sachbuch, hat man die Möglichkeit, jenseits von Phrasen zu gucken, was übrig bleibt.
JB: Was bleibt denn übrig in Mitgenommen?
AG: Zuerst einmal das reine Überleben, das sehr menschlich ist. Dann ein gewisses Mitleid. Es gibt im Buch beispielsweise eine mir sehr bedeutende Stelle, in der dem Major in Gefangenschaft ein Kind Mitleid schenkt. Es bleibt auch eine gewisse, sehr kurze Intimität. Und schließlich war mir das Ende des Romans wichtig. Lina ist am Ende noch immer da. Und der Roman endet im Deutschen mit dem Satz: »Er sagt: Ich bleibe noch etwas.« (742) Das ist auch schon etwas Menschliches: Dass man bleibt, dass man nicht weggeht.
MS: Seit Ihrem großen Göttinger Roman Der Vogel ist krank (2003) ist Ihr Werk durchsetzt von realpolitischen Katastrophen. Könnte man sagen, dass Nine Eleven eine starke Zäsur in Ihrem Werk darstellt?
AG: Ich war ja an diesem Tag in New York und habe einen Beitrag geschrieben für eine holländische Zeitung. Ich habe noch nie so böse Leserbriefe erhalten. Drei Tage später stand der Artikel in der Zeitung und ich habe in ihm einfach beschrieben, was in New York so vorging. Am Abend wurden schon Witze über das Ereignis erzählt. Weil alle Restaurants geschlossen waren, saßen Geschäftsleute im Hotel und teilten sich Pizza und Bier. Und es war gute Stimmung. Das durfte man aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht schreiben. Es kamen dann viele böse Reaktionen.
Ich habe damals immer widersprochen, wenn gesagt wurde, dass das das Ende der Ironie sei. Nicht das Attentat selbst, sondern das, was es hervorrief (zwei Kriege usw.), ließ in mir das Gefühl aufkommen, dass ich nicht so tun könnte, als wären wir noch im Jahr 1998. Auf die Frage, ob der 11. September eine Zäsur in meinem Werk ist, will ich also antworten: Es könnte sein. Aber ein Schriftsteller sollte meines Erachtens sein eigenes Werk auch nicht zu viel analysieren. Aber Ihre Analyse finde ich nicht falsch.
MS: Sehr freundlich.
JB: Bleiben wir mal beim Thema Sagbarkeitsregeln. Mir scheint, als hinterfrage Ihr Roman Sprache moderner Kriegsführung, was man am Beispiel der Umkodierung der Bezeichnung für Söldner veranschaulichen kann. Söldner werden die ›Hunde des Krieges‹ genannt und sind in ihrer Funktion in den privatisierten Kriegen, die in den letzten Jahren in Europa, Afrika und auch Südamerika geführt werden, ja die großen Kriegs-Gewinner. Bekanntermaßen engagier(t)en unterschiedliche Regierungen private Sicherheitsfirmen, um Söldner Konflikte ›lösen‹ zu lassen. In Mitgenommen heißt es wiederum, die Hunde des Krieges waren eigentlich die invaliden Armeeangehörige, »die man nicht rechtzeitig erschossen hatte, erst vergessen vom Tod und zuletzt auch von den Lebenden.« (332) Die Hunde des Krieges sind demnach diejenigen, die im Zwischenraum zwischen Leben und Tod zurückbleiben. Was ist angesichts gegenwärtiger internationaler Kriege und bewaffneter Konflikte Ihrer Meinung nach die Aufgabe von Schriftstellern und literarischer Sprache?
AG: Wie gesagt, Aufgabe der Literatur finde ich zu groß. Aber ich empfand es als meine Aufgabe. Ohne diese Reisen mit der US Army im Irak und der holländischen Armee in Afghanistan hätte ich mich nie getraut, den Roman zu schreiben, weil ich die Armee ja nicht kannte. Obwohl es damals, als ich 18 war, noch Wehrpflicht gab, war ich nie in der Armee.
Zuerst zu den Hunden des Krieges: Es gibt ja viel mehr verwundete als getötete Soldaten, nicht nur in den USA, auch in Holland. Über die Verwundeten liest man ab und zu einen Artikel, aber ansonsten sind sie unsichtbar in der Berichterstattung. Und in den USA war das ein ganz großer Skandal. Ich war einmal im Walter-Reed-Hospital, wo die Umstände für die Kriegsverwundeten aufgrund der finanziellen Situation schrecklich waren. Obwohl der Staat ja immer sagt, und das muss er auch tun: Wir lassen niemanden zurück, wir stehen hinter unseren Soldaten!
Aber es stimmt. Man sollte die moderne Kriegsberichterstattung, nicht nur die journalistische, sondern auch die offizielle Sprache der Armee, analysieren. Es gibt ja, ohne das jetzt vergleichen zu wollen oder zu sagen, das sei dasselbe, ein Buch von Klemperer über die Sprache des ›Dritten Reiches‹. Man sollte eine solche Analyse nicht in einem Roman, sondern vielleicht von einem Linguisten machen lassen. Um versuchen zu verstehen, was da verkauft wird. Obwohl das keine Aussage ist, ob ich für oder gegen diese Kriege bin. Als ich embedded war, fand ich gerade sehr interessant, wie die Euphemismen wirken, wie über Krieg geredet wird. Und den Unterschied, wie die Soldaten reden und ein Presseoffizier das dann an die Öffentlichkeit bringt.
JB: Können Sie uns ein Beispiel nennen?
AG: Mir wurde einmal von einem Vorfall erzählt: Ein Soldat war auf eine Mine gelaufen. Ein Rettungsversuch wurde dann in einer gemeinsamen Operation der Holländer und Amerikaner unternommen, dabei wurde dann ein Amerikaner getötet. Später wurde versucht, die Leichen zu bergen, aber ein Bein konnte nicht geborgen werden. Die Jungs, die Soldaten wollten das Bein aber nicht zurücklassen. Deshalb haben sie gelogen und weitergegeben, dass sie einen Luftangriff bräuchten. Daraufhin hat man dann von zwei holländischen F-16-Kampfjets das Bein bombardiert.
Den Pressebericht habe ich dann später gesehen und darin hieß es lediglich: Zwei Soldaten, ein Holländer, ein Amerikaner, sind getötet worden. Die Geschichte über die gesamte Rettungsaktion ist natürlich eine andere als diejenige, die der offizielle Bericht preisgibt – die Sprache, die ich hier einfach nicht reproduzieren kann, aber die wir alle kennen.
JB: Aber die Bilder können Sie ja in Literatur zeigen. Ich fühle mich nämlich stark an eine Szene in Ihrem Roman erinnert.
AG: Ja, genau. Diese Bilder. Aber die Brutalität des Krieges kann man nicht zeigen. Wenn man die Presseoffiziere fragt, warum sie lügen, weil sie ja schließlich genau wissen, was passiert ist, dann sieht man, dass es immer gute Ausreden gibt, um zu erklären: Wir können das nicht so sagen. Die Ausreden finde ich faszinierend. Das gilt ja auch für den Major in meinem Roman. Die Presseoffiziere sagen dann: Die Familie will es nicht wissen. Das ist zu schrecklich. Aus humanistischen Gründen wird dann so etwas weggelassen. Und irgendwie kann man das auch verstehen, dass man als Mutter oder Vater eines Soldaten nicht wissen will, dass das Bein zurückgeblieben und bombardiert worden ist.
JB: Was genau meinen Sie damit, man kann Krieg nicht in Bilder fassen? Würden Sie sich beispielsweise gegen eine Verfilmung dieses Romans wehren?
AG: Nicht unbedingt. Ich meinte eher Bilder in Nachrichten. Ich arbeite ja auch für Zeitungen. Und es gibt Grenzen der Zeigbarkeit. Wenn ein Bericht oder ein Foto zu grausam ist, kommen Leserbriefe, und Zeitungen werden ja auch von Kindern gesehen. Das sind dann auch wieder gute Gründe, um etwas ›wegzuschieben‹.
MS: In einigen Passagen Ihres Romans parodisieren Sie, so unser Eindruck, magischen Realismus südamerikanischer Prägung. In der Textstelle mit der Großmutter beispielsweise, oder das Motiv des Toten unter den Lebenden. In einer Verlagsankündigung wurde das treffend als »magischer Irrealismus, wie ihn nur Grünberg schreiben kann« formuliert. Ist Mitgenommen der zynische Gegenentwurf zum literarischen Südamerikabild, so wie wir es kennen?
AG: Nein, nicht unbedingt. Die Stelle mit der Großmutter spielt ja in einem Dorf bei den Minen. Ich habe viel recherchiert für diesen Roman und war auch in Minendörfern in Bolivien. Jetzt zufällig haben wir wegen der Rettungsaktion in Chile etwas mehr über diese Welt erfahren. Aber die Umstände in Bolivien sind um einiges härter. Dort gibt es Dörfer, die nur weiterexistieren, weil noch Gold in den Minen ist.
Als ich einmal in einem solchen Dorf war, hörte ich draußen wiehernde Geräusche wie die eines Pferdes. Toiletten gab es nicht im Haus, man musste hinter das Haus gehen. Und ich dachte: Da steht ein Pferd. Ich gehe doch nicht auf Toilette, wo auch ein Pferd steht. Als ich dann nachfragte, sagte man mir: Das ist nur unsere Großmutter. Sie spürt keine Kälte mehr. Deshalb sitzt sie draußen. Das war für mich Realismus: Eine Großmutter, die draußen in der Kälte sitzt, die sie nicht mehr spürt, die nicht mehr spricht, aber Geräusche wie ein Pferd macht. Daneben die Toilette.
JB: Wenn das schon Realismus ist, möchte ich gar nicht wissen, was die Magie ist.
AG: (lacht) Das war purer Realismus. Wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre, hätte ich mich auch nicht getraut, diese El Tío-Geschichte und die Abläufe in den Minen so zu schreiben. Und das Motiv des lebenden Toten ist auch realistisch, weil es, was mir sehr wichtig war an diesem Buch, mit dem Überleben zu tun hat. Der Preis des Überlebens kann sein, dass man noch lebt, aber gleichzeitig das Gefühl hat, eher zu den Leichen zu gehören. Also für mich ist dieses Buch, jedenfalls nicht bewusst, keine Parodie auf den magischen Realismus. Eher aus psychologischen Gründen. Und manchmal gibt die Wirklichkeit Schriftstellern auch Geschenke wie die Episode mit der Großmutter. Dieses Geschenk konnte ich nicht liegen lassen.
JB: Manchmal geben einem ja auch Lektoren Geschenke. Was halten Sie denn vom Geschenk Mitgenommen, vom Titel der deutschen Übersetzung im Vergleich zum Originaltitel? Das ist ja schon eine Verschiebung der Lesart. Lina wird ja von mehreren Onkeln mitgenommen. Und der Onkel, es soll nicht zuviel verraten werden, hat ja eine wichtige Funktion…
AG: … stimmt, und es ist ja auch nicht klar, wer genau dieser Onkel ist: Diese Männer, von denen Lina mitgenommen wird, der Staat? Ich bin der Meinung, aber vielleicht ist das nicht besonders tatkräftig, wenn ein Verleger im Ausland zu mir sagt, dass eine wörtliche Übersetzung des Titels nicht geht und gute Gründe für einen anderen Titel hat, dann stimme ich zu. Es geht ja darum, was drinnen steht. Solange man nichts am Inhalt des Romans ändert, bin ich zufrieden.
Aber ich habe auch nie gedacht, dass sich die gesamte Lesart ändert. Ich hoffe, dass der Inhalt stark genug ist, dass der Leser das Buch so liest, wie ich es glaubte zu schreiben. Der Onkel ist sicher eine wichtige Figur. Es geht ja um einen Onkel, dem man gehorchen muss, der Opfer verlangt. Der sagt: Wenn du das für mich tust, tue ich das für dich. Der Staat ähnelt hierin dem Onkel in den Minen. Also, ich finde Mitgenommen gut. Um ehrlich zu sein, finde ich den holländischen Titel besser, aber da der Titel, wie mir erklärt wurde, im Deutschen nicht so ankommt, ist Mitgenommen prima.
MS: Es ging Ihnen somit wohl auch nicht darum, was ich in einigen niederländischen Kritiken gelesen habe: Diese Kritiker lasen in Ihrem Roman ein deutliches Postulat eines Werterelativismus?
AG: Nein, das stimmt. Absolut nicht. Rezensenten können sich ja auch irren.
JB: Ein anderes Angebot von uns: Ist es eine Art Bildungsgeschichte im kapitalistischen Sinne? Es wird ja die Geschichte einer Figur, Linas Entwicklung und Reise von einem schweigenden Mädchen zu einer geschäftstüchtigen Frau rekonstruiert.
AG: Und wo kommt der Kapitalismus hinzu?
JB: Das wäre die Ebene der Staatlichkeit, der Repression und der Zusammenhänge, die aufgemacht werden, um deutlich zu zeigen, dass alles ineinander verstrickt ist.
AG: Stimmt. Und es ist ja auch kein Zufall, welchen Beruf Lina wählt.
JB: Genau. Kommen wir am Ende auch ans Ende Ihres Romans, zum Verhältnis von belletristischer und journalistischer Literatur. Im letzten Kapitel von Mitgenommen versucht ein Journalist »so nah wie möglich zu kommen« (733). Woran auch immer, Wahrheit vielleicht. Journalismus oder Literatur, wer kommt denn näher heran?
AG: Beide versuchen ja, so nah wie möglich heranzukommen. Ich verstehe mich in erster Linie als einen Schriftsteller von Romanen. Die journalistischen Arbeiten, die ich dazu mache, sind mir sehr wichtig, weil sie mich auch auf Ideen für Romane bringen. Deshalb werden Sie nicht überrascht sein, wenn ich sage, dass ein Roman das eher schafft. Wenn man für eine Zeitung schreibt, gibt es andere Zwänge. Die Frage danach, ob etwas noch wichtig ist, ob die Leute das lesen wollen. Ein Redakteur sagt beispielsweise: Heute ist etwas in Australien passiert, wir haben aber nur noch 300 Wörter für diese Nachricht. Also bereits praktische Gründe erschweren es Journalisten, obwohl sie in Wirklichkeit sehr nah an etwas herangekommen sind, darüber wiederum in Zeitung oder Fernsehen so zu berichten, wie sie wollen. Ein Schriftsteller hat viel mehr Möglichkeiten, das auszudrücken, was er will.
MS: Unsere Abschlussfrage. In den Niederlanden wurde bereits Ihr neuer Roman »Huid en Haar« angekündigt. In bester Grünbergmanier kündigt der Verlag an: »Eine Geschichte über perverse Vorlieben, Verführung, verbotene Liebe und Machtmissbrauch.« Verraten Sie uns kurz, worum es gehen wird? Und wird es eine deutsche Übersetzung geben?
AG: Doch, der Verlag wartet auf ein Gutachten von Herrn Kersten. Und ich war vor zwei Tagen in Zürich, wo mir einer der Verleger sagte, dass sie darüber nachdenken, diesen Roman noch vor dem Jüdischen Messias herauszubringen. Aber ich möchte eigentlich nichts über den Roman sagen. Er ist noch nicht da und dann sprechen wir über ein ungeborenes Kind.
JB: Aber vielleicht lassen Sie uns wissen, wie die Ausgangssituation ist?
AG: Es beginnt in Frankfurt am Main.
JB: Das ist sehr gut; das reicht mir. Herr Grünberg, wir bedanken uns herzlich für dieses schöne Gespräch.















