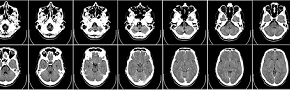Wer im Jahr 2000 jung, reich, schön und gebildet in New York ist, hat höchstens Probleme im Sex and the City-Format: verunglückte Liebeleien oder einen kaputten Designerschuh. Warum sehnt sich Moshfeghs Protagonistin nach einem Jahr der Ruhe und Entspannung? Und warum fasziniert die müde Geschichte sogar das deutsche Feuilleton?
Von Tanita Kraaz
Benennen lässt sich die Verwirrung über die Faszination nicht besser als mit Dennis Pohl und seiner Spiegel-Rezension: Bei dem Buch handle es sich um den »ereignisärmsten Page Turner der letzten Jahre«. Diesen scheinbaren Widerspruch versucht er, aufzulösen, indem er mit der Sprache der Autorin argumentiert. Die beeindruckt tatsächlich und wurde außerdem von Anke Caroline Burger anstandslos ins Deutsche übertragen. Der Spiegel-Autor ist da auf einer Linie mit anderen Rezensent*innen. So erklärt Luise Checchin in der Süddeutschen Zeitung: »Der Moshfegh-Ton ist stets genau beobachtend, distanziert und nicht selten zynisch.« Dass das als Spannungserklärung nicht genügt, übersieht sie allerdings nicht. Sie koppelt die Beobachtung an Moshfeghs Figurenentwürfe, die sich auszeichneten »durch eine fundamentale Entfremdung von der Welt, in der sie leben.«
In dieses Argument stimmt auch Sandra Kegel in ihrer sonst kritischen Besprechung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein und spezifiziert den Reiz der Protagonistin aus: Es sei »eine weibliche Dekadenzfigur, eine, die sich ihren Ennui leisten kann.« Die überprivilegierte Ich-Erzählerin berichtet genauso distanziert von ihren täglichen Kioskbesuchen, wie von ihren verstorbenen Eltern. Selbst nach der absurden Szene, in der sie nach Feierabend inmitten von laseräugigen, ausgestopften Hunden in die Galerie defäkiert, die ihr gerade gekündigt hat, spricht sie lediglich von »einem Gefühl in mir«, das sie nur annäherungsweise bestimmt: »Das fühlte sich an wie Rache.« Wohingegen trotz ihres Zugangs zur Hochkultur eine ganz profane Pop-Ikone zu ihrer Heilsbringerin wird: »Wenigstens blieb mir Whoopi Goldberg – ein Grund, weiterzuleben.« Das Figurenkonzept arbeitet Moshfegh stilistisch fein aus. Es ist zynisch und witzig. Gut, aber – da hat Sandra Kegel recht – damit handelt es sich trotzdem um keine literarische Neuigkeit. Auch das kann keine 320-seitige Faszination aufrecht erhalten.
Magere SelbstoptimierungEs erfrischt tatsächlich weniger die scheinbar ungerührte Dekadenz der Protagonistin als ihre souveräne Kapitulation davor, sich dieser Zuschreibung zu entziehen. Denn selbstverständlich und ihr ganz bewusst gehen ihre Probleme tiefer als Designerschuh und Liebelei. Erstmal ist ihre Liebesbeziehung nicht nur verunglückt, sie ist schlicht missbräuchlich. Darüber hinaus böte aber auch ihre familiäre Vergangenheit genügend Ansatzpunkte, um handfeste Traumata herbeizupsychologisieren. Statt sich deswegen mit ihrer verantwortungslosen Psychiaterin Dr. Tuttle einer Gesprächstherapie hinzugeben, lügt sie ihre Geschichte so zurecht, dass die Ärztin ihr möglichst starke Beruhigungs- und Schlafmittel verschreibt.
In dieser Konstellation mag man ein »Problem« sehen, so wie Jörg Magenau im Deutschlandfunk Kultur. Müßige Kausalitätsversuche werden im Keim erstickt. Nur selten wird das Motiv, sich den eigenen quälenden Erinnerungen entziehen zu wollen, genannt. Mit dem hedonistischen Plan, sich durch das Schlafjahr schlicht zu erneuern, kann dieses Motiv hinsichtlich der Deutungshoheit allerdings kaum konkurrieren. Es gibt dementsprechend keinen echten Erkenntnisgewinn über die literarische Figur. Durch diese Problematisierung rückt allerdings in den Hintergrund, dass Moshfegh so ihrer Protagonistin erlaubt, sich einem überdeterminierten Narrativ zur Figurenpsychologie zu verwehren. Was daraus resultiert, mag »redundant« wirken, wie Magenau beteuert. Genauso gut kann einen die Dramaturgie des pseudowissenschaftlichen Selbstexperiments auch erst in den Bann ziehen.
Roman

Ottessa Moshfegh, aus dem Englischen von Anke Caroline Burger
Mein Jahr der Ruhe und Entspannung
Liebeskind: München 2018
320 Seiten, 22,00€
Aus der blassen Idee erwächst das fixe Projekt »Winterschlaf«. Im Trial-and-Error-Verfahren tastet sich die Protagonistin an die ideale Mischung und Dosierung zum möglichst umfänglichen Wachentzug heran – ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Nicht zuletzt illustriert das die Medikamentierung: an sich offensichtlich gesundheitsgefährdend, aber auch mit mittelbaren Folgen verbunden. Am prominentesten taucht der Gewichtsverlust auf, um den ihre einzige Freundin die Protagonistin kruderweise beneidet. »Nicht fair!« kommentiert die wiederholt. Die Einbettung des Plots in die 2000er Jahre Folklore legitimiert die Absurdität: Das weibliche Schönheitsideal der endenden VHS-Ära, das die Protagonistin betrauert, war noch auf das Schlagwort Magerwahn eingestellt. Damit bildet der Roman ein Zerrbild zur Gegenwart, in der das Schlagwort Selbstoptimierungswahn heißt.
Eine ambivalente AntitheseMoshfeghs dritter Roman profitiert selbstverständlich vom Handwerk der Autorin. Zentral für die Faszination mit dem Buch ist aber ihre unverfrorene Idee »Winterschlaf«. Sie taugt zu mehr als bloß einem guten Teaser: Sie ist der perfekte Ausdruck für den Überdruss der Protagonistin und organisiert die Handlung des Romans. Zum Lesen verführt Mein Jahr der Ruhe und Entspannung als ambivalente Antithese zum Jetzt.