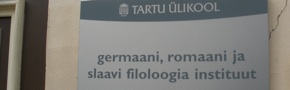Die Studierendenzahlen in der Germanistik sind hoch, über Inhalte wird weiterhin diskutiert. Von einer Krise des Faches im Jahre 2011 kann vor dem Hintergrund seiner Geschichte in den letzten vierzig Jahren nicht die Rede sein. Nach Bologna ist jedoch einiges zu tun. Schließlich ist nur ein Fach, das sich stets neu erfindet, krisensicher.
Von Julia Frese
1968 war zwar nicht nur in Deutschland ein politisch bewegtes Datum. Gerade hier hatten die so genannten Achtundsechziger allerdings eine besondere Aufgabe: Die Gräueltaten der NS-Regierung aus der Verdrängung zu holen und zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung dessen, was zwischen 1933 und 1945 passiert war, beizutragen. An prominenter Stelle engagierten sich für diese Ziele die Studenten. Sie wollten nicht länger hinnehmen, dass die Verbrechen, die im Nationalsozialismus unter der nationalsozialistischen Diktatur begangen worden waren, sowie ihre ideologischen Ursachen totgeschwiegen wurden.
Nicht verwunderlich ist, dass die Germanistik, die Philologie des zutiefst abgelehnten ›Deutschen‹, zu dieser Zeit einen schweren Stand hatte. »Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch«1, meinte Adorno provokativ. Enzensberger rief gleich ebenso provokant den »Tod der Literatur«2 insgesamt aus.
Die Literaturwissenschaft hatte sich ab 1945 in sicherer Distanz zu allem Weltanschaulichen gehalten. Es wurde darüber geschwiegen, welche der vor der NS-Zeit geborenen Professoren einstige NSDAP-Anhänger waren. Statt sich mit Historischem auseinanderzusetzen, galt die reine Ästhetik der Form, die »Neubesinnung auf die Sache selbst«3, wie es Max Wehrli formulierte, oder nach Karl Viëtor das »Wunder der dichterischen Form« als »phänomen sui generis«4. Der Freitag-Autor Winkler spricht gar davon, dass die »Innere Emigration« sich »als geistige und literarische Lebensform bis Anfang der sechziger Jahre«5 fortgesetzt habe. Es galt nur noch das ›Innerliterarische‹; jegliche Parallelen, selbst zu Nachbardisziplinen wurden aus den Augen verloren. Durch jene hermetische Einigelung gingen die Literaturwissenschaftler jeglicher Konfrontation mit der jüngsten Vergangenheit aus dem Weg.
Krisenstimm(ung)en und Aufrufe zum ›Ende des Schweigens‹ in den 1970ernZur offen ausgesprochenen »Krise der Germanistik« kam es in den 1970ern. Erste Anzeichen wurden bereits auf dem Münchner Germanistentag 1966 sichtbar. Auf der Veranstaltung unter dem Thema »Germanistik und Nationalismus«, auf der u.a. Eberhard Lämmert, Walther Killy, Karl Otto Conrady und Peter von Polenz referierten, entspannen sich so hitzige Debatten, dass ein paar jüngere Wissenschaftler wutentbrannt und Türen knallend den Saal verließen. Der »Deutschwissenschaft« wurde die Schuld zugewiesen, sich seit ihrem Anbeginn der Rationalität entzogen zu haben.6
Dass auch andere Wissenschaften wie die Soziologie, Philosophie, Theologie und nicht zuletzt die Medizin sich im ›Dritten Reich‹ durch ihre Experimente an KZ-Insassen schwer belastet hatten, im Grunde die gesamte Universität sich mitschuldig gemacht hatte, unterschlug man hierbei. Beim Germanistentag 1968 in Berlin hatte sich die Situation noch deutlich verschärft. Aufgrund von »Tumulte[n] und Megaphon-Duelle[n]«7, verursacht durch oppositionelle Studenten, musste die Versammlung abgebrochen werden.
Ähnlich wie dem Germanistentag erging es der legendären Gruppe 47, dem losem Schriftstellerbund, deren Teilnehmer sich ab 1947 auf Einladung von Hans Werner Richter regelmäßig zusammenfanden, um ihre Schreiberzeugnisse gegenseitig zu bewerten und bewerten zu lassen. 1967 protestierten bei einem Treffen der Gruppe Jugendliche mit Parolen wie »Die Gruppe 47 ist ein Papiertiger« und warfen den Autoren und Autorinnen vor, sich nicht entschieden genug politisch zu positionieren.
Einige der Schriftsteller reagierten mit aggressiven Gegenangriffen. Der damalige Teilnehmer Yaak Karsunke erinnert sich, wie unangemessen er die Reaktionen seiner Kollegen fand, und erklärt sie zum Hauptgrund für die Auflösung der Gruppe 47: »Für meine Begriffe ist [die Gruppe 47] […] nicht am Eindringen der Außenwelt zerbrochen, sondern an der Unfähigkeit der Gruppe, darauf angemessen zu reagieren.8
Auch der Literaturprofessor Jost Hermand, der 1950 in Marburg sein Germanistikstudium begann, weiß von einer ideologischen Umorientierung im Laufe seiner Wissenschaftskarriere zu berichten. »Nach den Schrecken der Kriegsjahre und der unmittelbaren Nachkriegszeit wollten viele sechzehn- bis siebzehnjährige Gymnasiasten, wie ich, nichts mehr von Politik hören«9, erinnert er sich. Seine Leidenschaft habe »möglichst ›edel‹ ausgedrückten Gefühlen« und »düster schwärmerische[n] Gedichte[n]« gegolten, die unpolitisch und unmodern waren, und die er in »selbstbezogene[r] Isoliertheit«10 las. Ab 1953 seien Josts Zweifel an einer »rein ästhetisch-elitären Literaturbetrachtung allmählich immer größer«11 geworden, bis schließlich in den 1960ern die Zahl derer wuchs, die sich für eine umfassende Vergangenheitsaufarbeitung in möglichst allen Gesellschaftsschichten engagierten.
Dabei wurde auch an ehemals unhinterfragten Eminenzen wie Emil Staiger, Gottfried Benn, Martin Heidegger und manchen anderen kein gutes Haar gelassen. Zwar findet Hermand, dass es ein wichtiger Schritt für das Fach Germanistik war, »endlich den Weg der Ideologiekritik einzuschlagen«, bedauert aber, dass hierbei »einiges schöne Geschirr zerschlagen wurde«12 und letztlich viel Erhaltenswertes eine so radikale Ablehnung erfahren habe.
Die Germanistik galt den politisch Linken jener Tage als ideologische, konservative, weltfremde, kurzum nicht mehr studierbare Wissenschaft. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie sich nur wenige Jahre zuvor in niederster Art und Weise instrumentalisieren lassen hatte.
Im Kreuzfeuer der studentisch-linken Kritik stand insbesondere die Epoche der Romantik sowie ihre gefühlte Überhöhung und Idealisierung durch die Literaturgeschichtsschreibung. War doch ein Teil der Romantiker in Reaktion auf die damalige Herrschaft Napoleons in Europa an der Stärkung einer deutschen Nationalkultur interessiert gewesen und stand damit für die protestierenden Studenten in gedanklicher Verbindung zum Nationalsozialismus. »Schlagt die Germanistik tot, färbt die blaue Blume rot!« war, in Anlehnung an das romantische Symbol der ›blauen Blume‹, eine beliebte Agitationsparole bei Demonstrationen. Während einige forderten, die erstarrten Strukturen des Fachs aufzubrechen und eine ›linke Germanistik‹ zu stärken, wollten andere gleich eine Abschaffung der deutschen Philologie insgesamt erwirken.
Versuche der NeuorientierungDer gemäßigtere Flügel der linken Kritiker bemühte sich ab den 1970ern um eine Neudefinition des Fachs, eingedenk jener Defizite, die zu seiner prekären Situation geführt hatten. Es wurde versucht, die deutsche Philologie ideologiekritischer zu gestalten, sie politisch neu zu verorten und diese Verortung entschiedener nach außen zu tragen. Erstmals rückte hierbei auch die DDR-Literatur in den Fokus des Forschungsinteresses, was teilweise zu einer unreflektierten Überbewertung neuer Werke und ungerechtfertigter Herabsetzung der Bedeutung ehemaliger Kanonliteratur führte.
Silvio Vietta etwa äußerte sich kritisch über die 1979 bei Metzler erschienene Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart: »Die Romantikdarstellung dieser Literaturgeschichte ist […] vom Ansatz her falsch oder zumindest sehr einseitig.«13 Allein die Tatsache, dass der Abschnitt über die »Aufklärung und klassisch-romantische Kunstperiode« – ein Zeitabschnitt von etwa 130 Jahren – nur 51 Seiten des Gesamtumfangs der Deutschen Literaturgeschichte ausmachte, während die DDR-Literatur für einen Zeitraum von 33 Jahren 44 Seiten zugedacht bekam, erscheint Vietta irrsinnig. Zudem spreche für »die Einseitigkeit dieser Literaturgeschichte«14 das Bild, das sie von der DDR-Literatur zeichne: »Die Verhältnisse in der DDR werden im Sinne einer linken Germanistik der BRD naiv idealisiert und ideologisch schön geredet.«15 Die DDR werde »in großer Naivität« unter dem Begriff »Modell ›Literaturgesellschaft‹«16 präsentiert.
Eine weitere Neuerung der Germanistik der 1970er war, dass man erstmals die Linguistik mit ins Boot holte. An der Universität Bielefeld etwa gab es ab 1973 eine Fakultät für Literaturwissenschaft und Linguistik, was zum damaligen Zeitpunkt eine revolutionäre Kombination darstellte. Zuvor hatte die Germanistik lediglich aus den Bereichen Altdeutsche Literatur bzw. Mediävistik und Neuere Deutsche Literatur bestanden. Manch eingefleischtem Ästhetiker erschien es denn auch zu gewagt, Literatur und Sprache als die zwei Seiten einer Medaille zu betrachten und damit gar die Grenzen der Nationalphilologien aufzuweichen.
Krise vorbei. Fach vorbei, im Chaos deutscher Bildungspolitik1997 titelte Ulrich Greiner in der Zeit, die »Krise der Germanistik« sei überwunden. In erster Linie sei die Überwindung der Krise allerdings damit zu erklären, dass die Germanistik in ihrer herkömmlichen Form schlichtweg nicht mehr existiere. Schuld daran waren laut befragter Professoren die Neuen Medien, die dazu führten, dass vielen Abiturienten »die Kunst des Lesens […] unvertraut«17 sei. Filme und das Internet seien die heute üblichen Gesprächsthemen unter Jugendlichen. Somit werde die Germanistik immer interdisziplinärer, werde mehr eine Medien- und Kulturwissenschaft und entferne sich immer weiter von ihrem ursprünglichen Gegenstand: der Literatur.
An das Fach Germanistik werde außerdem vielfach mit den falschen Erwartungen herangegangen, der Lektüreaufwand unterschätzt, manchmal aus Verlegenheit Literaturwissenschaft studiert, weil ein alternativer Berufswunsch nicht geklappt habe. Daraus resultiere dann auch die hohe Abbrecherquote in dem Fach: »Von hundert Studienanfängern machen weniger als fünfundzwanzig einen Abschluss.«18
Neben einer Unterschätzung des Fachs schienen 1997 aber auch die wenig rosigen Karriereaussichten für Geisteswissenschaftler insgesamt eine Rolle zu spielen. Studierte man etwas so ›Gesellschaftsfremdes‹ wie Germanistik, so musste man auch einer der Besten darin sein. Ansonsten war die Taxifahrerlaufbahn vorprogrammiert, so schien es vielen. Wer dies nicht riskieren wollte, orientierte sich neu, solange das noch möglich war.
Der »Germanist als prädestinierter Taxifahrer«, hält Carsten Celle, Germanistikprofessor der Ruhr-Universität Bochum, dagegen, »der ist eine Mär«19. Auch in der Vergangenheit schon sei es den Absolventen seines Studiengangs meist ohne große Verzögerung gelungen, in einen Beruf einzusteigen – sei es als Bibliothekar, Verlagslektor oder Berater einer PR-Agentur. Ist das Arbeitsmarktproblem also ein so altes, dass es Carsten Celle nicht mehr miterlebt hat? Oder ist es tatsächlich nie so schwierig gewesen, als Germanistikabsolvent einen Job zu finden, wie es viele behaupten?
Zurück zur Bestandsaufnahme in den 1990ern. Desillusionierte Dozenten werden dafür verantwortlich gemacht, dass die deutsche Philologie nicht mehr ist, was sie einmal war. »Die enttäuschten 68er, die bildungsfeindlichen Linken und verbeamteten Solipsisten«. Sie alle hätten ihre Begeisterung für Literatur und Lehre längst verloren, brüteten nur noch missmutig auf ihren Planstellen, so sah es Jürgen Manthey von der Universität Essen.20
Germanistik im Jahr 2011Auch noch im Jahr 2010 macht sich statistisch gesehen ein Rückgang des Interesses an der deutschen Philologie bemerkbar. Das allerdings vor allem im Ausland, wo immer weniger Menschen Deutsch lernen wollen. Hans-Jochen Schiewer, Rektor der Freiburger Universität und Mediävist hält es jedoch für eine falsche Herangehensweise an das Problem, wenn man immer wieder die Krise der Germanistik als Erklärung hervorkrame. Wichtiger sei es sich zu fragen, woran man arbeiten könne, um das Deutschlernen für Ausländer in Zukunft wieder attraktiver zu gestalten.21
Nach wie vor steht die Forderung an die Germanistik, sich nicht aus Politik und Gesellschaft herauszuhalten, sondern sich in Bezug auf diese aktiv und engagiert zu verhalten. Als eine wichtige Basis für ein politisches Mitreden der Sprach- und Literaturwissenschaft sieht Jost Hermand bspw. ökologische Belange. Seien diese in den 1980ern und 1990ern noch als apokalyptische Zukunftsspinnereien belächelt worden, gewinnen sie heute zunehmend an Aktualität.
Die Kultur- und Geisteswissenschaften haben sich der ökologischen Systemkritik gegenüber bisher weitestgehend verschlossen, bemängelt Hermand, »[w]ährend sie sich anderen neuen Diskursen – seien sie nun geschlechtsspezifischer, minderheitorientierter, feministischer, postmoderner […] oder semiotisch-struktureller Art«22, also eher humanozentrischen Themen gegenüber, sehr aufgeschlossen gezeigt haben. So habe es in den 1980er und 1990er Jahren erste Sammelbände, Monographien und Tagungsprotokolle gegeben, die sich des Themas annahmen, wie etwa Natur und Natürlichkeit. Stationen des Grünen in der deutschen Literatur (1981) Öko-Kunst? Zur Ästhetik der Grünen (1989) und Mit den Bäumen sterben die Menschen. Zur Kulturgeschichte der Ökologie. Ohne die Forderung aussprechen zu wollen, dass sich die germanistische Literaturwissenschaft in Zukunft ausschließlich mit biozentrischen Themen beschäftigen solle, wünscht sich Hermand doch ein beträchtliches Mehr an Aufmerksamkeit für ökologische Fragen durch die Kultur- und Geisteswissenschaften.
Gerade in Zeiten der zunehmenden Bedrohung durch ökologische Katastrophen sei dies für die Geisteswissenschaften eine Möglichkeit, ihren gesellschaftlichen Nutzen zu beweisen. Dies scheint auch wirtschaftlich betrachtet eine geschickte Strategie zu sein, denn wie Michael Becker-Mrotzek, Professor an der Universität Köln und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für angewandte Linguistik, anmerkt: »Die Gesellschaft fördert auf Dauer jene Disziplinen, die ihr bei der Lösung ihrer Probleme helfen. Die anderen werden irgendwann als überflüssig wahrgenommen.«23
Nichts von einer angeblichen Germanistik-Krise zu spüren, sei in Marbach, meint Eva Jost. Dort treffen sich im Deutschen Literaturarchiv junge Deutschstudierende aus aller Welt, Stipendien für Magister-, Master- und Staatsexamenskandidaten gibt es zuhauf. Die Stipendiaten sind vielfach begeistert von der bestens ausgestatteten Bibliothek und der Ideen fördernden Atmosphäre unter den internationalen Studenten. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Irland berichtet »auf der Dachterrasse des Gästehauses mit Wissenschaftlern, Doktoranden und Studenten aus Neuseeland, China und Togo über deutsche Literatur diskutiert«24 zu haben.
Auch die bundesweiten Studierendenzahlen im Fach Germanistik sieht Jost als einen Beweis dafür, dass der Begriff Krise völlig unangebracht ist. 80000 sind derzeit als Deutschphilologen eingeschrieben, womit sie unter den 1,7 Millionen Hochschülern die viertgrößte Gruppe darstellen – hinter BWL, Maschinenbau und Jura. Im Ausland rangiere das Deutschstudium auf der Beliebtheitsskala sogar an zweiter Stelle. Die Stuttgarter Professorin Sandra Richter sieht somit in der Globalisierung eine Herausforderung und Chance für die Germanistik. Sie hat das bi-nationale Promotionsnetzwerk »Internationalisierung in Wissenschaft und Literatur seit der Frühen Neuzeit« gegründet, das vom DAAD bezuschusst wird und mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, dem Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung und dem King’s College London kooperiert.
Dem digitalen Zeitalter werde ebenfalls von unterschiedlichen Seiten Rechnung getragen: »Unter dem Stichwort Digital Humanities wird untersucht, wie die neue Technik für die geisteswissenschaftliche Forschung nutzbar gemacht werden kann.«25 Vorreiter sind hier das King´s College London sowie in Deutschland die Computerphilologen Fotis Jannidis von der Universität Würzburg, Gerhard Lauer von der Universität Göttingen und Jan-Christoph Meister von der Universität Hamburg. Ihr Ziel ist es, »digitale Editionen, Fachdatenbanken und Archive zu erstellen, die zeit- und ortsunabhängig genutzt werden können und so interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern«.26
Attraktiver soll das Germanistikstudium auch durch stärkere Praxisbezüge der neuen Bachelorstudiengänge werden. An der Universität Heidelberg gibt es dafür seit 2007 die Dozentur »Germanistik in der Gesellschaft«, die Studierenden dabei hilft, sich über ihre Berufsperspektiven zu informieren. In Bayreuth gibt es Bachelor-Modula in Jura und BWL, um das germanistische Studium marktorientierter zu gestalten; die Universität Bamberg bietet zum selben Zweck zusätzliche Seminare in Verlags- und Urheberrecht an.
Letztlich wird das Germanistikstudium durch solche Maßnahmen sicher anwendungsorientierter. Traditionalisten warnen allerdings vor einer zu großen Beliebigkeit von Studieninhalten und dadurch Selbstgefährdung des Fachs. Auch das Streben nach dem universitären Exzellenzstatus ist häufig ein zweischneidiges Schwert. Die Fachbereiche, die dem Ansehen der Professorinnen und Professoren nach eine Spitzenstellung innehaben, erzielen bei den Studierenden hingegen die miesesten Umfragenoten. Der Status als Exzellenzuniversität scheint sich in der Lehre negativ auszuwirken, konstatiert Oliver Jahraus, Germanistikprofessor der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Anders sieht es in Bochum aus, wo Studienbedingungen und Betreuung durchweg Spitzenbewertungen von den Studenten erhalten. Eine große Rolle spielt hier sicher, dass die Studierenden bei der Wahl ihrer Module weit mehr Freiheiten haben als Studierende an anderen deutschen Universitäten. Man könne sich auch Teilveranstaltungen anrechnen lassen und es gebe »keine Bologna-Polizei«, so Carsten Zelle. »[W]ir machen, was wir für richtig halten.«27
Es bleibt zu hoffen, dass andere Universitäten dem guten Beispiel folgen werden. Denn nur wenn ein Fach die Möglichkeit hat, sich immer wieder neu zu erfinden, ist es krisensicher.
- Theodor W. Adorno: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft (1951). In: Ders.: Kulturkritik und Gesellschaft I. Gesammelte Schriften. Bd. 10,1, hrsg. von Rolf Tiedemann. Darmstadt 1998, S. 30. ↩
- Vgl. Hans Magnus Enzensberger: Kursbuch 15 (1968). ↩
- Max Wehrli: Allgemeine Literaturwissenschaft. Bern 1951, S. 53 f. ↩
- Karl Viëtor: Literaturgeschichte als Geistesgeschichte. Ein Rückblick. In: Publication of the Modern Language Association of America 62 (1945), S. 899-916; 916. ↩
- http://www.freitag.de/2004/11/04111401.php ↩
- Helmut Arntzen: Unsinn und Sinn der Germanistik. Weinheim 1996, S. 45. ↩
- Vgl. FAZ vom 10.10.1968 ↩
- Heinz Ludwig Arnold: Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. München 1987, S. 129–130. ↩
- Jost Hermand: Allmähliche Entzauberung. Emil Staiger und die Marburger Junggermanisten der frühen Adenauer-Ära. In: Ders.: Fünfzig Jahre Germanistik. Oxford 2009, S. 305. ↩
- Ebd., S. 306. ↩
- Ebd., S. 316. ↩
- Ebd. ↩
- Silvio Vietta: Kanon- und Theorieverwerfungen der siebziger Jahre. In: Germanistik der siebziger Jahre. Zwischen Innovation und Ideologie, hrsg. von Silvio Vietta und Dirk Kemper. Hildesheim 1998, S. 28. ↩
- Ebd., S. 30. ↩
- Ebd., S 32. ↩
- Ebd. ↩
- http://www.zeit.de/1997/14/Die_Krise_der_Germanistik_-_vorbei ↩
- Ebd. ↩
- http://www.zeit.de/2010/19/C-Germanistik ↩
- Ebd. ↩
- http://www.badische-zeitung.de/kultur-sonstige/das-risiko-die-identitaet-zu-verlieren–35518916.html ↩
- Jost Hermand: Der »Aufhaltsame Aufstieg« der Grünen und die zögerlich folgende Germanistik (2004). In: Fünfzig Jahre Germanistik. Aufsätze – Statements – Polemiken, 1959-2009. Oxford 2009, S. 299. ↩
- http://www.zeit.de/2010/19/C-Germanistik ↩
- http://www.magazine-deutschland.de/de/artikel/artikelansicht/article/zwischen-schiller-und-netzkultur.html ↩
- http://www.magazine-deutschland.de/de/artikel/artikelansicht/article/zwischen-schiller-und-netzkultur.html ↩
- Ebd. ↩
- http://www.zeit.de/2010/19/C-Germanistik?page=2 ↩