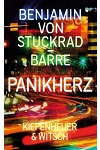Rechtfertigungsdruck, schematisierende Darstellungen und zu viele Informationen. Wenn Personen der Öffentlichkeit ihre psychischen Krankheiten aufarbeiten, ist das schnell befremdlich. Thomas Melle und Benjamin von Stuckrad-Barre lösen das Unbehagen mit unähnlichen Strategien.
Von Eva Tanita Kraaz
Wenn eine berühmte Person unter einer Krankheit leidet, die für die Öffentlichkeit spürbar ist, stellt das häufig einen ungewollten Bruch mit ihrer üblichen Inszenierungsstrategie dar. Soll sie sich gänzlich zur Kunstfigur stilisieren? Ihr Problem vehement abstreiten oder vielleicht einfach doch versuchen, unbeirrt und arglos fortzufahren? – Thomas Melles Antwort ist der radikal offene Umgang mit der Krankheit. In Die Welt im Rücken erklärt er mit einem einfachen Bild, dass das ziemlich viel Sinn ergibt: Es steht ein »elephant in the room«. Ob er für alle zu sehen ist oder nicht, liegt nicht in seiner Hand. Darauf, wie er verstanden wird, hat er Einfluss.
Ein Krankheitsbericht also…Unbehagen als Reaktion auf diese Strategie ist verständlich. Die Krankheitsberichte prominenter Personen verfallen häufig in einen apologetischen Duktus, dem das Selbstbewusstsein inhärent ist, eine Katharsis durchlaufen zu haben. Daher gehen sie auch oft Hand in Hand mit Bußversprechen. Das ist deshalb befremdlich, weil das wahnsinnig intim ist – und dem Gros der Öffentlichkeit ziemlich egal. Noch befremdlicher ist aber, dass es auf tragische Weise die Lebensdauer psychischer Krankheiten verkennt. Diese Schematisierungsfalle umgeht Melle, indem er parallel stehende Wahrheiten ineinander verzahnt. Er beginnt mit seinem ungefilterten manischen Ich.
…oder ein bewusst unvollkommenes Puzzle»Als ich Sex mit Madonna hatte […]« ist der feuilletongefeierte Halbsatz, der nonchalant das zweite Kapitel einleitet. Die vielbesprochene Unmittelbarkeit ist durch das zwischenzeitliche Aussetzen eines übergeordneten Erzählerkommentars gewährt. Nur das Tempus schafft hier die Distanz zum Erzählstoff. Als Marker für Paranoia und Wahn dient vorläufig lediglich der Zusammenfall der unwahrscheinlichsten Begebenheiten. So ist der Erzähler sich im Verlauf der oben erwähnten Seite sicher, dass jeder Madonna-Song heimlich ihm gewidmet ist und vergleicht die Qualität seiner Affäre zu Madonna mit der zu Björk. Erst mit Abschluss der Madonna-Episode setzt die Reflexion ein. Weniger tadelnd als ungläubig über sich selbst erklärt er: »Als Madonna weg war, war sie weg, und nichts war geschehen. So war es meist zu jener Zeit […] Die Ereignisse waren intensiv, aber folgenlos.«
Durch diese ineinander verzahnten Wahrheiten erzeugt Melle die Erwartung eines Puzzles: ein Gesamtbild der Krankheit, das sich in der Zusammenschau der Einzelteile ergibt. – Und enttäuscht die Erwartung meisterhaft. Die Erinnerung an die Kindheit in sozial prekären Umständen instrumentalisiert er nicht als monokausale Erklärung seines Zustands, genauso wenig wie die Häufung psychischer Krankheiten in seiner Familie. Medizinische Ausführungen sind interessante Notizen, die keine umfangreiche Auslegung der Person ermöglichen. Die nachempfundene Perspektive der Freunde beleuchtet das Dilemma, das sich aus zurückgewiesener Hilfsbereitschaft und verantwortungslosem Rückzug ergibt, und die Auszüge aus alten Tagebüchern sind lediglich Dokumente der wahnhaften Phasen. Es fehlen die Teile, die ein womöglich erhofftes stimmiges Bild ergäben; handelte es sich tatsächlich um ein Puzzle, es wäre maßlos frustrierend. Dass sich Melle eindeutigen Erklärungsmustern verwehrt, ermöglicht aber erst eine befriedigende Rezeptionserfahrung. Gerade die scheinbar konfuse Einsicht in die Krankheit eröffnet einen differenzierten Blick auf Erkrankte und damit eine Sensibilisierung. Komische Klinikaufenthalte
Melle ist nicht alleine mit der schonungslosen Darstellung seiner Lebenshindernisse. Sein Buch wurde wiederholt in Zusammenhang mit Benjamin von Stuckrad-Barres Panikherz gesetzt. Im vergangenen Jahr beschrieb er darin seine Karriere; inklusive Drogensucht, Bulimie, Geltungssucht und Abstürzen. Beide Autoren hatten sich bereits literarisch fiktionalisiert mit den Hürden ihrer Krankheiten auseinandergesetzt. In 3000 Euro zitiert Melle beispielsweise seine eigene finanzielle Sorge über ein Gerichtsverfahren an, in dem er für seine Unzurechnungsfähigkeit bei der Aufnahme von Schulden plädierte – passagenweise unterscheiden sich auch Soloalbum und Panikherz beinahe ausschließlich durch das unterschiedlich zugeschriebene Verhältnis von Autor und Ich-Erzähler. Während Melle die Fiktionalisierung in Die Welt im Rücken nachträglich als solche markiert, sieht Stuckrad-Barre munter über solche Details hinweg. Anders als Melle, der seine Krankheit gedankenvoll hadernd anhand seiner Person untersucht, benutzt er seine Vergangenheit als Zeugnis für seine extreme Person.
Die Absurditäten aus Melles manischen Phasen entbehren zwar einer selbstironischen Komik nicht, Stuckrad-Barre aber arrangiert seine Essstörung regelrecht zu spöttischen Anekdoten. Zynisch gibt er beispielsweise seine Tricks für schmerzfreies Kotzen preis:
[…] man musste vor einem Fressanfall und währenddessen sehr viel trinken, Apfelschorle war gut, obwohl die Fruchtsäure brannte an den bald chronisch eingerissenen Mundwinkeln, auch Buttermilch eignete sich gut und hatte ja nur ein Prozent Fett. Hundert Prozent Lesesaalauslastung, ein Prozent Fett – das ist das Glück.
In der Art wie Melle Krankheit und Kunst in Beziehung setzt, ist die inszenatorische Funktion geringer. Es liest sich fast wie eine kämpferische Agenda, wenn er Schematisierungen kritisiert:
Die pseudoarchetypischen Bilder, die Hollywood unter dem dämlichen Label ‚Genie und Wahnsinn‘ von den Kranken produziert, sind mir verhasst, denn die Filmindustrie trägt so nur ihren beträchtlichen Teil zur Dämonisierung und gleichzeitig auch Glorifizierung von psychischen Defekten bei.
Obwohl Melle aufklärerisch und demütig einen differenzierten Kontrapunkt zur schwärmerisch-zerrissenen Perspektive Stuckrad-Barres darstellt, haben beide Autoren trotz des Rechtfertigungsanlasses, der jedem autobiographischen Krankheitsbericht inhärent ist, eine wohltuende Gemeinsamkeit: Keiner der beiden erzählt sich als gebeugt. So ist es neben dem facettenreichen Einblick und der Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit psychischer Krankheiten besonders die gelungene Ermächtigung über die eigene Selbstdarstellung, die die Bücher bedeutend macht.
Spätestens an dieser Stelle zeigt sich auch der Voyeurismus als Faktor im Lesegenuss. Wenn über verschiedene Formen der Aufarbeitung geurteilt wird, dann ist das immer überheblich – und ein bisschen eklig. Von der Autorität autobiographischen Berichtens übermannt, kann dabei nicht mal der Einsatz von geballtem Pathos auf Melles letzten Seiten befremden. Nachdem er seine auslaugenden drei Krankheitsphasen erzählt hat, in denen er sich finanziell und sozial ruiniert hat, deutet er sein Buch als Dokument seiner Krankheit und mahnt sich selbst:
Sollte ich eine weitere Manie haben, möge mir jemand dieses Buch in die Hand drücken. Sollte ich wieder dem Wahn verfallen, werde ich es als Schicksal hinnehmen. Ich meinte schon nach der zweiten Manie, eine dritte würde ich nicht überleben. Habe ich aber. Würde ich wieder. Ich mag mich wieder umbringen wollen, irgendwann. Dann werde ich dennoch weiterleben.
Dann werden diese Zeilen wie ein Gebet sein.