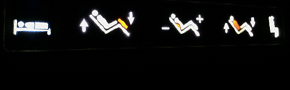Die einen halten ihn für die sprachliche Pose eines Kulturkonservativen, die anderen für den großen Gesellschaftsroman unserer Tage. Martin Mosebachs aktueller Roman Was davor geschah ist aber keines von beiden.
Von Christian Dinger
In der Villa der Hopstens, in einem Frankfurter Vorort, herrscht Sonntagnachmittags ein reges Treiben. Im Sommer wird im Pool gebadet und Weißwein getrunken, der leicht und mild ist wie Wasser. Im Winter finden die Partys in verkleinerter Runde im Haus bei gutem Essen statt. Die Gesellschaft ist generationenübergreifend, es finden sich altehrwürdige Wirtschaftsmagnaten, neureiche Yuppies und verwöhnte Studenten in der trotz aller Exklusivität heterogenen Runde. Aber Martin Mosebachs Roman Was davor geschah hält sich nicht bei diesen Klischeebildern auf. Er zeichnet ein präzises Bild von dieser Sonntagnachmittagsgesellschaft und den Wechselwirkungen unter ihren Mitgliedern.
Der Roman beginnt mit einer Frage an den Ich-Erzähler, der im weiteren Verlauf immer im Hintergrund verweilt und letzten Endes für den Leser die fremdeste Figur dieser Geschichte bleibt. Eine Frau, mit der er vor Kurzem zusammengekommen ist, fragt ihn, wie es gewesen sei, als sie sich noch nicht kannten: »Ach, das war nichts Besonderes, das war so…« Und damit beginnt die Geschichte um das Ehepaar Hopsten, die sich perfekt aneinander angepasst zu haben scheinen und schließlich doch aus ihrer Ehe ausbrechen wollen; um ihre Tochter Phoebe, die mit der Zuneigung des Erzählers spielt; um die alten Schmidt-Flex und ihren Sohn, der unter dem übermächtigen Vater und seinen eigenen Minderwertigkeitskomplexen leidet.
Der Roman endet schließlich mit der Auflösung der sonntäglichen Treffen und der Begegnung des Erzählers mit der Person, der er diese Geschichte erzählt. Von dieser Person wird von Zeit zu Zeit der Erzählfluss unterbrochen, wenn sie seine Erzählkompetenz infrage stellt. Wie kann ihr Gegenüber so detailliert von Ereignissen berichten, bei denen er zum Teil gar nicht anwesend gewesen sein konnte? Der Erzähler rechtfertigt sich, indem er seine Erzählung mit einer Patience vergleicht:
Und so wie diese Patience ist jede Geschichte im Leben aus offenen und umgedrehten Karten zusammengesetzt, du wirst schon selber erkennen, welche Karten verdeckt waren – aber am Ende ist nur wichtig, daß die Patience aufgeht.
Und die Patience geht auf. Aber was heißt das für Mosebachs Roman?
Seine Fangemeinde sieht in ihm den großen Gesellschaftsroman unserer Tage und in Mosebachs Sprache einen Gegenentwurf zum Plauderton, der sich oft in der Gegenwartsliteratur einschleicht. Seine Kritiker stoßen sich an den kulturkonservativen Ansichten des Autors und sehen in seinen Romanen eine sprachliche Pose und einen Aufguss antiquierter Erzählweisen.
Es stimmt, Neues und Innovatives ist von Mosebach nicht zu erwarten und vielleicht kann daher aus seiner Feder tatsächlich kein Gesellschaftsroman unserer Tage entstehen, den – warum auch immer – alle Feuilletons der deutschen Presse heißblütig zu erwarten scheinen. Unbestritten ist jedoch, dass er wie kaum ein anderer sein Handwerk beherrscht. Seine Sprache mag veraltet sein, wenngleich kaum so veraltet wie die der „experimentellen“ Erzähler und Lyriker, die weit hinter den Experimenten des Expressionismus und anderer Epochen zurückbleiben. Seine Sprache vermag den Leser zu fesseln und trägt ihn auch durch langatmige Passagen, lässt ihn sogar vergessen, dass er sich überhaupt nicht um die Probleme und Intrigen der Frankfurter Oberklasse schert.
Was davor geschah ist mehr als eine sprachliche Pose, mehr als das verspielte Projekt eines Routiniers. Es ist ein poetisches Buch, das Anerkennung verdient, auch wenn sich unter diese Anerkennung die Enttäuschung mischt, dass es vielleicht nicht der große Gesellschaftsroman unserer Tage ist, dass es nicht das Lebensgefühl unserer Zeit wiedergibt.