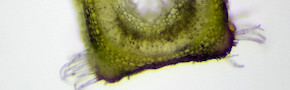Californication zeichnet L.A. als großen Süßigkeitenladen für erwachsene Kinder, in dem für jede Vorliebe etwas dabei ist. Aber lohnt es sich, dem Schriftsteller Hank Moody sieben Staffeln lang zu folgen?
Von Simon Gottwald
Sex, Drugs, Rock’n’Roll und ein wenig Literatur – so lässt sich Californication zusammenfassen. Hank Moody, problembeladener Schriftsteller und Hauptfigur der Serie, verbringt mehr Zeit mit Drogen, Alkohol und Frauen als mit dem Schreiben, obwohl er sich eigentlich nach einem recht spießigen Familienleben mit seiner (Ex-und-dann-doch-wieder-und-dann-wieder-nicht-und-dann-doch-wieder) Partnerin und »Babymama« Karen und der gemeinsamen Tochter Rebecca sehnt. Während der sieben Staffeln, über die Moody von den ZuschauerInnen begleitet wird, wird jedoch vor allem eines klar: Man kann nicht aus seiner Haut heraus, so sehr man es sich auch wünschen mag.
Hank hat die seltene Gabe, dass so gut wie jede Frau, die er trifft, ihm verfällt, was in der oberflächlichen Welt von Hollywood und Umgebung bedeutet, dass einmal (selten öfter) miteinander geschlafen wird, um anschließend wieder getrennte Wege zu gehen. Doch mit wie vielen Frauen Hank auch schläft, wie viele von ihnen sich auch in ihn verlieben: Er sehnt sich nur nach Karen, der Liebe seines Lebens. Seine Beziehung zu ihr ist aber mit ›schwierig‹ noch untertrieben betitelt. Karen erträgt sein Verhalten, das sich vor allem durch Unreife und Verantwortungslosigkeit auszeichnet, nur etappenweise, obwohl sie Hanks Liebe im Grunde erwidert. Verkompliziert wird die Beziehung der beiden noch durch die gemeinsame Tochter Becca, die das Verhalten ihres Vaters schon in jungen Jahren durchschaut und entsprechend desillusioniert ist.
Dabei ist Hank Moody nicht die einzige Figur der Serie mit einem ausschweifenden Sexualleben. Die libidinöse Desorientierung der prominenten und halb-prominenten Oberschicht äußert sich in dem Erforschen von immer neuen Fetischen, dem Konsum von immer abgehobenerer Pornographie und, im Falle von Hanks Agent Charlie Runkle, einer irgendwann aus der Übersättigung und Desensibilisierung resultierenden erektilen Dysfunktion, der Charlie zunächst mit einer Entwöhnungskur und der Konzentration auf ganz gewöhnlichen Sex zu begegnen versucht. Diese wird aber nur in den Momenten überwunden, in denen Runkle sich seinem neugefundenen Cuckolding-Fetisch hingibt und fantasiert, wie seine Frau mit ihrem Exmann schläft. Runkle ist die Figur, die die allermeisten Mitleids-Lacher in die Serie bringt – im Bett kaum fähig, länger als eine Minute durchzuhalten und von seiner Frau Marcy deshalb »Prema-Charlie« genannt, verliert er seine Arbeit wegen wiederholten Masturbierens am Arbeitsplatz, versucht sich als Agent einer Pornodarstellerin, gibt sich, um bei seiner alten Agentur wieder einzusteigen, als schwul aus, tötet versehentlich den Affen eines Autoasphyxie praktizierenden Produzenten (»That monkey was a deviant and a cockblocker!«) und kommt am Ende nach diversen Eskapaden doch wieder mit Marcy zusammen, die sich zwischenzeitlich von ihm getrennt hatte.
Trotz dieses stellenweise geradezu monomanischen Fokus’ auf die Sexualität in all ihren Spielarten ist Californication aber nicht einfach ein Softporno in Serien-Form. Vielmehr ist es so, dass das dekadente Zeitvertreiben in Form von Nippelklemmen, tabubrechenden Rollenspielen (»Let’s do the one where Charlie is still your husband but he’s upstairs in a wheelchair«) und sexualisierter Gewalt (»I think we should kill someone tonight – I mean, like a hobo or something«) den Hintergrund für die Diagnose einer generellen Langeweile, eines Ennui, bietet: Die Welt der Figuren von Californication ist eine Welt, in der Oralsex eine Währung und ›gewöhnlicher‹ Sex allgegenwärtig und immer verfügbar ist. Diese Kommodifizierung und gleichzeitige Entwertung menschlicher Intimität ist es, die die Figuren zu Drogen und Alkohol greifen lässt, mal zur Beförderung der Avancen, mal als ihre Folge oder als Mittel, mit den Konsequenzen einer gescheiterten Liebschaft umzugehen, und häufig als Versuch der Langeweile des Wohlstands zu entfliehen.
Es ist ein Wohlstand, der den Eltern erlaubt, ihre Kinder bei der Nanny abzuladen und ihr die Erziehung des Sprosses aufzubürden. Wenn das Kind aufgrund dieser elterlichen Vernachlässigung nicht spricht, wird der Fehler bei ihm gesucht und die Beschäftigung mit ihm nur so sehr ausgeweitet, wie Therapiebesuche das erfordern. Dass das erste Wort von Runkles zweijährigem Sohn »Blowjob« ist, ist bei all dem wenig überraschend.
Serie
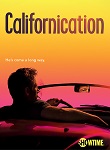
Autor/in: Tom Kapinos
Showtime 2007
Episoden: 84 in 7 Staffeln
Genre: Dramedy
Californication, Staffel 1-7, wird auf Netflix gestreamt
Die Großstadt, eine Vielzahl von Sexpraktiken und das Schreiben darüber – gab es das nicht schonmal? Californication ist ganz entschieden nicht einfach ein ›krasseres Sex and the City‹ oder welche Formulierungen man auch immer verwenden will, um eine Beziehung zwischen den beiden Serien zu konstruieren. Parallelen sind zwar vorhanden (die Ubiquität von Sex, die Queste nach dem Seelenpartner Mr. Big/Karen, die sexgeschwängerten Betrachtungen des jeweiligen Hauptcharakters, die in geschriebener Form ihren Ausdruck finden), aber Californication thematisiert die eigene Künstlichkeit ebenso wie die Künstlichkeit der Beziehungen seiner Figuren. Dass David Duchovny sich 2008 zu seiner Sexsucht bekannte, einen Master in Englischer Literatur hat und in Californication gerade einen sexsüchtigen Schriftsteller spielt, ist nur ein kleiner Teil dieser Selbstreflexion. Wenn Duchovny als Hank Moody in seiner Funktion als Serienautor das Geheimnis erfolgreicher Fernsehserien verrät (»Milk the sexual tension for as long as inhumanly possible«), ist das zum einen ein ironischer Blick auf Hanks zu diesem Zeitpunkt bereits fast achtzig Episoden dauernden Bemühungen, Karen endgültig für sich zu gewinnen, zum anderen aber auch eine deutliche Anspielung auf die Beziehung zwischen Fox Mulder (von Duchovny gespielt) und Gillian Andersons Charakter Dana Scully in The X-Files. Wie lange hatten die Fans damals darauf gewartet, wenigstens einen Kuss zwischen diesen beiden zu sehen, was erst im Kinofilm Wirklichkeit wurde, und wie enttäuscht mussten viele gewesen sein, als aus diesem Kuss nicht mehr wurde, obwohl die ›sexual tension‹ zwischen den beiden bestehen blieb.
Momente wie dieser, in denen gezeigt wird, wie albern es ist, Simulakren anzubeten, bilden das Herzstück von Californication. Der ständige und überall praktizierte Sex ist nur ein Vorwand, um dieses eigentliche Thema der Serie auszubreiten: Natürlich ist es albern, wenn bei der Beerdigung eines Rockstars seine Freunde vor einem Gitarre spielenden Hologramm des Verstorbenen auf die Knie fallen und ihm huldigen; natürlich kann man es kaum ernst nehmen, wenn sich im Musikstudio ein Schuss löst, weil einige Mitglieder der Crew des Rappers Samurai Apocalypse darüber streiten, wer von ihnen weine, weil der Gesang von Hanks und Samurais gemeinsamem ›love interest‹, der Sängerin Kelly, so berührend ist, aber genau darum geht es. Fast alles in Californication ist überzeichnet: Die Menschen, ihr Aussehen, ihre Gefühle, der Sex. Nichts hat Bestand, alles demontiert sich selber, blickt man nur näher hin. Der spontane Sex auf der Männertoilette entpuppt sich als Pornodreh, der vermeintlich schwule Agent hat über seine Sexualität gelogen, um einen neuen Kunden zu gewinnen, der »Slam Van«, eines jener Pornostudios, die eine einzige Sparte bedienen, hier das Szenario »willige Anhalterin zeigt sich erkenntlich«, ist ein schmuddeliges Zweimann-Unternehmen mit Knebelverträgen und kaum nennenswerten Erträgen, die angebliche Feministin mit dem bezeichnenden Namen Ophelia würde am liebsten alle Männer kastrieren oder wenigstens in ein »male chastity device« stecken und zitiert zum Beweis ihrer kruden Thesen ihre eigenen Selbsthilfebücher.
Die einzige Ausnahme davon bilden Hank und seine kleine Familie. Denn trotz aller Leere in zwischenmenschlichen Beziehungen ist Californication voller Hoffnung, dass wahre Liebe existiert. In einer Welt, in der Abhängige ihre Sucht eloquent rechtfertigen können, in der der Besuch einer Entzugsklinik ein notwendiges Übel ist und Sex nur ein Zeitvertreib unter vielen, gibt es Gefühle, die selbst L.A. mit all seinem schlechten Einfluss auf die Menschen nicht zerstören kann. Hank liebt Karen und Karen liebt Hank, egal, was passiert oder mit wem in den Intervallen zwischen ihren Beziehungen geschlafen wird, und so ist es kein Spoiler, wenn hier das gute Ende für alle Beteiligten verraten wird.
Californication ist ohne Frage eine kluge Serie, die gerade in den ersten Staffeln mit bewundernswerter Leichtigkeit literarische Werke wie Nabokovs Lolita mit dem Schmuddel der Punk- und Rockmusik vermischt, den Schriftsteller nach Hunter S. Thompson und Charles Bukowski modelliert und mit schmächtigen Feingeistern nichts anfangen kann (»Most writers aren’t handsome. They are usually pale, sun-starved, man-titted little weaklings like your friend here«). Aber leider erstarrt vieles ab Staffel 5 zur Pose: Wieder muss irgendein Fetisch eingeführt werden, wieder muss Runkle irgendeine peinliche sexuelle Eskapade erleben, wieder leidet Hank darunter, wie unzuverlässig er doch ist und ertränkt seinen Kummer, wieder gibt es irgendeine skurrile Figur, die ihren Drogenkonsum und ihr Sexleben nicht im Griff hat. Dieses Muster ist zwar auch in den vorherigen Staffeln zu finden, aber dort stellt sich noch nicht das Gefühl ein, dass seelenlos eine Liste abgearbeitet wird, bloß um beim Altbewährten zu bleiben und kein Risiko einzugehen. Was jedoch noch viel schlimmer ist: Nach der 4. Staffel wird der Ton von Californication böser, manchmal sogar geradezu feindselig. Der große Lacher einer Episode aus Staffel 5 ist, dass Charlie Runkle sich als Polizist ausgibt und eine Prostituierte auf diese Weise zum Oralsex bewegt, danach jedoch feststellen muss, dass es sich bei ihr um eine Transsexuelle handelt. Selbst Vergewaltigungen sind dann irgendwie doch ganz lustig, zumindest für die Autoren von Californication. Als eine Frau sich Hank in der Entzugsklinik aufzwingt, soll das zum Lachen sein, schließlich wollen Männer doch immer und ständig Sex haben, und so geht Hanks erster Schock, der ihn beinahe dazu bringt, die Klinik zu verlassen, auch unter in seinen weiteren Reaktionen auf das Geschehene. »You think rape is funny?« »No! I think it’s awful! Unless it’s a woman raping a man. That’s inherently funny«, und die Frau, die ihn zum Sex gezwungen hat, wird von ihm grinsend mit »Hello rapist« begrüßt. Natürlich ließe sich einwenden, dass von einer Serie wie Californication bei keinem Thema Feingefühl und Takt zu erwarten seien, aber es bleibt einem dann doch oftmals die Luft weg.
Diese Bösartigkeit macht die Versuche, die Beziehung zwischen Hank und Becca als etwas Reines darzustellen, manchmal ziemlich peinlich: Natürlich eifert die frühreife und hochintelligente Tochter ihrem Vater nach und will ebenfalls Schriftstellerin werden; die von ihr vorgetragenen Teenagerbanalitäten werden vom Publikum eines Open Mic begeistert aufgenommen und mit großem Applaus honoriert, und ihr erster Romanentwurf wird von ihrem Vater zwar verrissen, doch schränkt der seine Kritik ein und stellt fest: »You know what I really dug about your work was … was the relationship between the daughter and the asshole father […] it felt authentic to me and … and I think if you flesh it out you could turn it into a novella«. Das passiert in der 6. Staffel, und längst hat die Serie einen Punkt erreicht, an dem Hanks Beziehung zu Becca und Karen zwar noch als Besonders definiert wird, aber im Grunde ist es, wie schon erwähnt, eine Ausdehnung der Unzulänglichkeiten Hanks in allem, was über eine Nacht hinausgeht.
Es ist, als ließe die Serie nur die kleine Welt Hank Moodys gelten und als wären alle anderen Lebensweisen, ob Pan- oder Asexualität, freiwilliges oder unfreiwilliges Singlesein, alles Streben nach Glück, das sich nicht mit dem Hanks deckt, verkehrt und verachtenswert. Alles ist ein großer Witz, alles ist lächerlich, außer der tragischen Hauptfigur, die unter ihrem eigenen Genie leidet.
So bleibt ein gemischter Eindruck zurück von einer Serie, die Oberflächlichkeiten verabscheut und einen zwar grenzwertigen, doch unterhaltsamen Humor mitbringt (außer an den Stellen, an denen es der eigene Anstand wirklich verbietet, auch nur zu schmunzeln), mit voranschreitendem Alter aber das wird, was sie so verachtet: Eine in Selbstmystifikation und ständiger Nabelschau erstickende Anhäufung von Gemeinheiten.