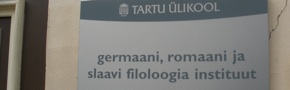Seelische Hypochondrie oder Wahn des Wahrhaften? Flucht in die Einsamkeit oder lieber doch mit dem eigenen entrückten Bild vom Menschsein unter Menschen bleiben? Der vorliegende Beitrag soll umreißen, wie die Weltliteratur das Menschenhass-Motiv aufgreift.
Von Stefan Walfort
Menschenhass mündet manchmal in Massenmord. Und manchmal resultiert Menschenhass aus einer Beglückungsideologie. Davon zeugen die Leichen derer, die in den Siebzigern Opfer einer aberwitzigen Theorie wurden: Um einen Urzustand zu restaurieren, in dem die Menschen noch im Einklang mit der Natur gelebt hätten, sei es unvermeidlich, die Menschen aus den Klauen des Urbanen zu retten. Mit vorgehaltener Flinte nötigten Pol Pots Schergen die Bevölkerung Kambodschas dazu, aufs Land zu ziehen. Wer sich nicht zu Tode marschierte, starb infolge der harten Arbeit, zu denen die selbsternannten Befreier jeden einzelnen verdonnerten, oder durch Exekutionen, zu denen schon verurteilt werden konnte, wer eine Brille trug oder sich anderweitig verdächtig machte. »[I]n vier Jahren [waren] von den 7890000 Einwohnern, die Kambodscha 1975 hatte, […] 21 %«1 ermordet worden. Zwar handelt es sich um ein Extrem. Doch es verdeutlicht, welche grausigen Kräfte eine Sehnsucht nach Rückkehr ins Paradies freisetzen kann.
Obwohl die Vordenker und Apologeten solchen Gedankenguts dazu animieren, sich aus der Liebe zum Garten Eden wie die Axt im Wald aufzuführen, präsentieren sie der Öffentlichkeit gerne nur die Sonnenseite ihrer Weltsicht. Das war schon bei Rousseau der Fall. Bei esoterischen Strömungen der Linken wie bei den »Naturschutz-ist-Heimatschutz!«-Rechten ist es noch immer so. Auch die Kulturbloggerin Agnes in Rebekka Kricheldorfs neuestem Drama Fräulein Agnes huldigt dem Eskapismus. Psychoterror soll ihren Liebhaber, den es der misanthropischen Logik nach eigentlich gar nicht geben dürfte, dazu motivieren, mit ihr ins Grüne zu ziehen. Doch über Agnes und Molières Lustspiel Le Misanthrope, nach dem Kricheldorfs Stück konzipiert ist, wird erst der zweite Teil der Litlog-Textreihe zur Misanthropie in der Kunst ausführlich berichten.
Von einem Extrem ins andereZum Thema wird Misanthropie erstmals zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr., insbesondere bei Aristophanes. In den Mittelpunkt rücken die Quellen einen Athener namens Timon. Es ist ein Phantom, das da durch die Literatur geistert ‒ anfangs nur durch die Komödien, ein Jahrhundert später auch durch die Lyrik. Ist die Existenz eines echten menschenhassenden Timon auch nirgends bezeugt, so wird sein Name dennoch zum Inbegriff der Misanthropie. Im 17. Jahrhundert verhilft ihm Shakespeare mit dem Drama Timon von Athen endgültig zum Durchbruch. Seitdem hat sich das Sujet zum »zeitlose[n] und übergesellschaftliche[n] Phänomen« gemausert, »das von jeder Epoche, von jeder Gesellschaft eine andere Bewertung und künstlerische Darstellung erfährt«.2 Ambivalenzen, von denen sich Misanthropen meist geschüttelt fühlen, nimmt die Literatur entweder zum Anlass, um sie als »Narr[en]«3 darzustellen oder um sie als verkappte Philanthropen zu demaskieren und so für Mitgefühl für sie zu werben.
Bei Shakespeare ist von beidem noch wenig zu sehen. Sein Timon kippt vielmehr von einem Extrem ins andere, von grundgütiger Ehrfurcht vor allen Menschen in einen Fanatismus, von dem er sogar seine Grabschrift noch Zeugnis ablegen lässt: »Hier ligt Timon, der alle Menschen hassete; gehʼ vorbey, und fluchʼ ihm bis du genug hast, nur verweile dich nicht hier.«4 Doch auch Shakespeare verrührt all die Tragik, in die sich Timon verstrickt, mit einer kräftigen Prise Komik. In ganz Athen gibt es keinen größeren Naivling. Weit und breit kennt niemand jemanden, der nicht schon in den Genuss seiner Spendierfreude gekommen wäre. Mit vollen Händen teilt er aus, was zu teilen da ist und darüber hinaus noch viel mehr. Alle Warnungen schlägt er in den Wind. »[K]omme mit einer bessern Musik wieder«5 ‒ solche Töne bekommt zu hören, wer es aufrichtig mit ihm meint und ihn vor der Gier seiner vielen falschen Freunde zu schützen sucht. Üppige Speisen lässt Timon auftischen. Manch einem hilft er mit Finanzspritzen aus der Patsche, und das so lange, bis »tiefster Winter in Timons Sekel«6 herrscht. Als er nun selbst auf die Hilfe von Freunden angewiesen ist, versuchen alle ihn mit Ausflüchten für dumm zu verkaufen. Einer treibt gar mit einst von ihm entgegengenommenen Klunkern um den Hals Schulden bei ihm ein. Seitdem braust der Furor in Timons Brust. Nachdem er alle noch einmal versammeln lässt, um bekannt zu machen, für wie verkommen er sie neuerdings hält, zieht er hinaus, dorthin, wo er meint, »die wildesten Thiere milder als den Menschen [zu] finden«.7
Den Philosophen Apemanthus schickt er los, er solle Athen dem Erdboden gleichmachen. Schon bei Shakespeares Timon gibt es also die Tendenz, Blutbäder anrichten zu wollen. Schon bei ihm geht sie einher mit einem religiös verquasten Fimmel: Als »Mutter […], deren unermeßliche Schoos und unbegrenzte Brust alles gebiehrt und säuget« betet er Humus und Grashalme an. Nicht mehr für das Überleben der anderen, nur noch für das seine und das der Tierwelt möge sie fortan sorgen, so fleht er.8
Einen absoluten Willen zum Hass weicht die Literatur immer mal wieder auf. Die Inkonsequenz, trotz vorgeblicher Misanthropie weiter nach Glück zu streben und dabei selbst die Liebe zu einem Menschen oder zumindest Verliebtheit zuzulassen, findet sich bei Molières Menschenfeind Alcest genauso wie in Tschechows Kurzgeschichte Der Roman mit dem Kontrabaß. Über den Musiker Smytschkow heißt es dort: »Nachdem er seinen Glauben an die Menschheit verloren hatte (seine heißgeliebte Frau war mit seinem Freund, dem Fagottisten Sobakin, durchgebrannt), war in seine Brust ein Gefühl der Leere eingezogen, und er war zum Misanthropen geworden.«9 Dennoch vergafft er sich in die nächstbeste Nackte, nachdem ihnen beiden beim Baden Unbekannte die Kleider klauen. Nur kann von aufrechter Liebe in der Regel nicht die Rede sein.
Ein weiteres Beispiel dafür hat uns Schiller hinterlassen: Von Hutten, die Hauptfigur in seinem 1790 veröffentlichten Dramenfragment Der versöhnte Menschenfeind, gibt vor, seine Tochter Angelika zu lieben, ja er scheint sie förmlich zu vergöttern. Ansonsten kann er niemanden ausstehen.
Die Gründe für seinen Groll lässt er im Dunkeln. Nicht einmal Angelika gegenüber will er sie konkretisieren. Angeblich trüge er sonst zu unerträgliche Bitterkeit in ihren »friedlichen Busen«.10 Er belässt es bei Schlagworten. Von »Verleumdung«, »Mißgunst« und »Zwietracht«11 ist die Rede ‒ allesamt Dinge, wie sie auch die anderen Misanthropen beklagen, allesamt klingen sie zum Teil gar nicht abwegig, auch wenn von Hutten sich vor Selbstmitleid zu maßloser Hyperbolik versteigt und behauptet: »Das ganze Geschlecht ist mein Mörder«.12 Denn ansonsten verweist er nur auf allzu menschliches. Zwar offenbart er ein Ideal, das den Menschen unmögliches abfordern würde, aber hat er nicht alles Recht der Welt, empört zu sein, wenn er die Zustände um ihn herum für unerträglich hält? Als er Angelika wünscht, sie möge eines Tages »eine neue und schönere Schöpfung«13 vorfinden, hat er da etwa Unrecht?
»Die Gerechtigkeit meines Hasses lebt von euren Lastern«14 ‒ so bringt von Hutten auf den Punkt, welche Abgründe sich unter seiner Schädeldecke auftun. Wie die meisten dieser speziellen Art von Gärtnern will er nicht primär Pflanzen zum Sprießen bringen. Vielmehr reizt es ihn, sich selbst zum Gott zu krönen, als Schöpfer tätig zu werden, Menschen zu formen. Denen blüht dann stets das gleiche: ein »Paradies der Unmündigkeit«.15 Bei von Hutten bekommt das allein seine ach so geliebte Tochter zu spüren; mit anderen gibt er sich ‒ zu deren Glück ‒ ja nicht ab. Angelika bürdet er auf, es ihm gleichzutun, sich in Einsamkeit zu flüchten und auf gar keinen Fall zu verlieben. Letzteres muss sie ihm wiederholt versprechen. Hinterrücks entscheidet sie sich für das einzig richtige: den Schwur zu brechen. Was von Hutten mit ihr anstellt, ist im Kleinen, was im Kambodscha der Siebziger Jahre Millionen heimsuchte.
Doch in solchen Extremformen begegnen Misanthropen uns nur selten, aber wenn, dann keinesfalls zwingend auf Kosten des Amüsements, wie schon angemerkt. Ein jüngeres Beispiel liefert Thomas Bernhards Roman Das Kalkwerk, wo Konrad, der Held, vorgeblich im Dienst der Wissenschaft seine zum Vegetieren im Rollstuhl verdammte und daher wehrlose Frau für ein Sprachexperiment missbraucht. Menschen stören dabei nur. Deshalb verschanzt er sich mit ihr in einer alten Fabrik jenseits aller zivilisatorischer Einflüsse. Die abgeklärte Rationalität, mit der er über das Handicap seiner Frau und dessen Vorteile für seinen Sadismus nachdenkt, zeugt von einer Monstrosität, mit der die meisten Menschen in ihrem Leben allenfalls im Fernsehsessel zu tun bekommen, so wie die meisten von den Killing Fields der Roten Khmer erfuhren, während sie sich gleichzeitig verschont fühlen durften.
Hüter der herrschenden DoppelmoralIm 18. Jahrhundert und noch darüber hinaus war »theologische Verdammung« das probate Mittel, um mit Misanthropen fertig zu werden. Das Hauptübel sei, dass sie »die Kardinaltugend der Nächstenliebe negiere[n]«.16 Mediziner erklärten die Störenfriede für meschugge ‒ das reichte als Legitimationsgrundlage. Bis in die Gegenwart lässt sich manchmal ein ähnliches Muster beobachten, beispielsweise im Kontext der G20-Resümees, unter deren Eindruck die seit Mitte dieses Jahres im DT zu sehende Inszenierung von Heinrich Manns Untertan aktueller denn je erscheint. Denn die Diederich Heßlings in Pöbel und Politik fordern ‒ teils erfolgreich ‒, die Justiz möge die Hamburger Randale mit möglichst langer Kerkerhaft vergelten. Und wie die Theologen des 18. und des 19. und wenn das so weitergeht auch noch des 35. Jahrhunderts erklären sie die Objekte, auf die sie eigene Gewaltfantasien projizieren, zu Feinden nicht der Zustände, sondern der Menschheit. Dabei würden die meisten das Attribut menschenfeindlich für sich wohl kaum akzeptieren. Dennoch bekommen sie es angepappt, zum Beispiel von der Ex-Linken Angela Marquardt im Cicero-Interview.17
Würden sich die Hüter der herrschenden Doppelmoral je selbstkritisch mit den Motiven ihrer Zeitgenossen beschäftigen, so könnten sie längst wissen: Je unerbittlicher sich jemand in die Rolle des Menschenfeinds gedrängt sieht, umso mehr nähert er sich dem Zerrbild an. Rousseau hat sich in hohem Alter nur noch augenzwinkernd gegen den Vorwurf, er hasse die Menschen, verwahrt: »Ich hasse sie nicht, denn ich vermag nicht zu hassen. Aber ich kann nicht umhin, sie zu verachten, wie sie es verdienen, und ich kann mich nicht enthalten, ihnen meine Verachtung auch zu bekunden.«18
Schon lange litt er unter ‒ durchaus faktenbasierter ‒ Angst vor übler Nachrede und Nachstellungen. Dabei schlich sich auch Paranoia in seine Gedanken hinein. Zwar hat er nur lange Spaziergänge in die Natur unternommen, nur Zuflucht beim »Grünzeug«19 gesucht und sich allen dazugehörenden spirituellen Quark eingeredet, dabei aber keinem Menschen ein Leid angetan. Doch zum Stichwortgeber für alle, die irgendwann nach »Rache an den Menschen«20 dürsten, wie es Timon ergeht, wie es von Hutten ergeht, taugt er allemal.
Trotzdem ist es sinnvoll, Menschen zuerst einmal Wohlwollen zu unterstellen, wenn sie in Zweifel ziehen, dass die Welt, in der sie leben, bereits die beste aller möglichen ist. Sogleich den Massenmörder zu wittern, wäre übertrieben. Differenzieren ist angesagt. Das heißt nicht, Menschen zu bestärken, wenn sie mit Pauschalurteilen um sich werfen. Auch ist Brutalität nicht hinzunehmen. Allen Dogmatikern, welcher Couleur auch immer, wäre ein bisschen von der Sanftmut, mit der Goethe das Thema Misanthropie angepackt hat, zu wünschen. In einigen Versen aus dem Jahr 1777 bekennt das lyrische Ich des Gedichts Hypochonder:
»Da nehm’ ich mir so eifrig vor: / Will niemand weiter sehen, / Will all das Volk Gott und sich selbst / Und dem Teufel überlassen! Und kaum seh’ ich ein Menschengesicht, / So hab’ ich’s wieder lieb.«21
- Vgl. Barth, Boris: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte • Theorien • Kontroversen. München 2006, S. 148 ‒ 155. ↩
- Wursthorn, Friederike: Der Misanthrop in der Literatur der Aufklärung, phil. Diss. Freiburg im Breisgau/Berlin/Wien 2013 (= Rombach Wissenschaften. Reihe Litterae, Bd. 195), S. 17‒27. ↩
- Vgl. ebd., S. 9. ↩
- Shakespeare, William: Timon von Athen. Übers. von Christoph Martin Wieland. Zürich 1993, S. 139. ↩
- Ebd., S. 39. ↩
- Ebd., S. 69. ↩
- Ebd., S. 90. ↩
- Vgl. ebd., S. 103f. ↩
- Tschechow, Anton: Vom Regen in die Traufe. Kurzgeschichten. Hrsg. von Gerhard Dick und Wolf Düwel. 3. Aufl. Berlin 1972, S. 546. ↩
- Schiller, Friedrich: Der versöhnte Menschenfeind. In: ders.: Sämtliche Werke, Bd 5. Berlin 2005, S. 239. ↩
- Ebd., S. 232. ↩
- Ebd., S. 239. ↩
- Ebd., S. 240. ↩
- Ebd., S. 232. ↩
- Martin, Dieter: Über den Umgang mit Menschenfeinden. In: Heinz, Andrea u.a. (Hgg.): Ungesellige Geselligkeit. Festschrift für Klaus Manger. Heidelberg 2005 (= Ästhetische Forschungen, Bd. 12), S. 176. ↩
- Ebd., S. 166. ↩
- Vgl. »Gewalt kann per se nicht links motiviert sein« ‒ »Neonazis waren es sicher nicht«. Streitgespräch zwischen Hugo Müller-Vogg und Angela Marquard, 14. Juli 2017, Url: http://cicero.de/innenpolitik/streitgespraech-gewalt-kann-per-se-nicht-links-motiviert-sein, letzter Aufruf: 12.09.2017. ↩
- Rousseau, Jean-Jacques: Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Übers. von Ulrich Bossier. Stuttgart 2014, S. 107. ↩
- Ebd., S. 116. ↩
- Martin, Dieter: wie Anm. 15. ↩
- Goethe, Johann Wolfgang: Gedichte. Hrsg. von Erich Trunz. München 2007, S. 133. ↩