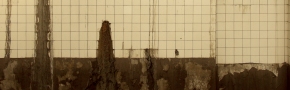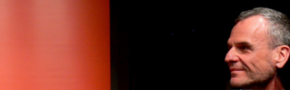Wenige Monate nach der so genannten Schlacht um Budapest im Zweiten Weltkrieg schrieb Sándor Márai Befreiung. Der Roman sollte nicht veröffentlicht werden. Nun liegt er in deutscher Übersetzung vor.
Von Christian Dinger
Als Sándor Márai 1989 im amerikanischen Exil starb, war sein Name hierzulande kaum jemandem ein Begriff. Erst mit der Neuübersetzung seines Romans Die Glut erlangte der ungarische Autor 1998 seinen späten Ruhm. Heute ist wohl unumstritten, dass dieser Mann zu den herausragenden europäischen Literaten des 20. Jahrhunderts gehört. Seit dem Erscheinen von Die Glut bringt der Piper Verlag nach und nach sein Werk heraus. Zuletzt erschien mit Befreiung (im Original: Szabadulás) ein Roman, den Márai selber nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatte. 1945 geschrieben, hielt er ihn jahrelang unter Verschluss, bis er auch in Ungarn erst nach seinem Tod entdeckt und publiziert wurde. Wenige Monate nach der Belagerung Budapests, von der der Roman handelt, schrieb Márai diesen Text nieder und man liest deutlich heraus, wie die Erfahrungen der Belagerungszeit im Erzählen ihr Ventil fanden, durch das sie mit aller Macht ihren Weg ins Freie suchten.
Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht der jungen Erzsébet, die im Budapester Winter von 1944 der Befreiung entgegen bangt. Befreiung vom Krieg, von den Deutschen, von den »Pfeilkreuzlern«, den ungarischen Faschisten, die auch in Zeiten allgemeiner Auflösung und Chaos unablässig auf der Suche nach ihrem Vater sind. Erzsébets Vater ist Wissenschaftler, ein schweigsamer Astronom, der trotz seiner Weltabgewandtheit Partei für Juden und andere Verfolgte ergriff, der als öffentliche Person dem Regime seine Zustimmung entzog und deshalb auch noch in seinen letzten Tagen von ihm verfolgt wird. Mithilfe eines ebenso schweigsamen wie scheinbar altruistischen Mannes gelingt es ihr, den Vater in letzter Minute in einen Keller einzumauern, bevor sie selber im Keller verschwinden muss.
Während oben Bombenhagel und Häuserkampf toben, sitzt Erzsébet im Luftschutzkeller zwischen untergetauchten Juden, Beamten, die sich eifrig vom System distanzieren, und Großbürgern, die sich ebenso eifrig mit ihren Untergebenen verbrüdern, weil sie wissen, dass in wenigen Tagen eine andere Ordnung herrschen wird. Stumm erträgt Erzsébet diese Zeit der Entbehrungen. Und sie wartet. Denn in ihr keimt die Hoffnung, dass alles anders werde, wenn die Belagerung ein Ende genommen und sie den Vater aus dem zugemauerten Kellerloch herausgeholt haben wird. Der gelähmte Mathematiker, der neben ihr im Luftschutzkeller sitzt, sieht das skeptischer. Er betrachtet den Einzug der Russen mit Misstrauen; Menschen im Allgemeinen betrachtet er misstrauisch, vorsichtig. Erzsébet nennt ihn den »Ungläubigen«.
Autor

Sándor Márai, geboren 1900 in Kaschau (heute Slowakei), lebte und studierte in verschiedenen europäischen Ländern, bis er 1928 als Journalist nach Budapest zurückkehrte. Er verließ Ungarn 1948 aus politischen Gründen und ging zunächst nach Italien, 1952 dann in die USA, wo er bis zu seinem Freitod am 22. Februar 1989 lebte.
Eine Erkenntnis, die auch für den Autor traurige Wirklichkeit war. Wenige Jahre, nachdem er diesen Roman schrieb, verließ er Ungarn, ging ins Exil und kehrte nie wieder zurück. Auch wenn er den Entschluss zu dem Zeitpunkt der Niederschrift des Romans noch nicht getroffen hatte, war ihm sicherlich schon bald nach Kriegsende das Gefühl von früh enttäuschter Hoffnung auf ein besseres, freieres Leben vertraut.
Erzählerisch erlebt der Leser in Befreiung einen ganz anderen Márai als zuvor. Während sich in Die Glut oder Die Möwe melodiöse Sätze noch mythenreich um die Geheimnisse der menschlichen Existenz winden, schlägt der Autor in Befreiung einen schnörkelloseren, fast nüchternen Ton an. Seine Sprache hat zwar nichts von ihrer wohlklingenden Präzision verloren, doch stehen in diesem Roman die konkreten Geschehnisse im Vordergrund. Der Krieg wird nicht mystifiziert. Márai setzte seine erzählerische Kraft bedacht – der Thematik entsprechend, nicht dem Wohlklang verpflichtet – ein.
Von dieser Thematik mag der ein oder andere deutsche Leser bereits übersättigt sein, kennt er Bilder von Frauen in Luftschutzkellern nun schon zu Genüge aus Film und Fernsehen der letzten Jahre. Doch muss man sich immer wieder bewusst werden, dass dieses Buch 1945 geschrieben wurde und keine Rekonstruktion von fleißigen Hobby-Historikern ist.
Und hin und wieder schafft es Márai, die Nüchternheit des Belagerungsszenarios zu durchbrechen und so einprägsam von der Tragödie des 20. Jahrhunderts zu erzählen, wie es nur wenige vermögen. So zum Beispiel, als er eine junge Frau, die apathisch neben Erzsébet im Keller wartet, vom Konzentrationslager erzählen lässt. Eindringlich und verstörend erzählt diese von dem Lagerarzt und der Bewegung, mit der er bei der Selektion über Leben und Tod entschied:
Nur ein Musiker kann so die Hand heben, mit dieser sanften und dennoch kräftigen, schwungvollen Bewegung, ein Dirigent, der über etwas herrscht, wenn er die Hand hebt, und der einen Takt spürt, verstehen Sie?
Betroffen legt man das Buch weg, wenn man bedenkt, dass auch für den, der diese Worte schrieb, kein Frieden nach dem Weltkrieg herrschte und er nach Jahren der Depression seinen Freitod im Exil wählte, bevor seine Worte auch uns so spät erreichten.