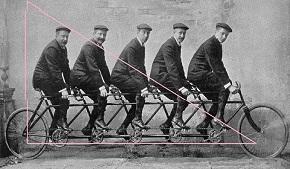Dieser Artikel enthält Spoiler für den gleichnamigen Roman, jedoch nicht für den Film.
Charlie Kaufmans neuer Film I’m Thinking of Ending Things auf Netflix gibt sich als Horrorfilm aus, ist aber eigentlich ein bombastisches Feuerwerk der Metafiktion. Das ist eher anstrengend anzuschauen, denn bei aller Ambition bleibt der Film erstaunlich altmodisch.
Von Hanna Sellheim
Wohl kaum eine Situation hat das Potenzial, so viele unangenehme Gespräche hervorzubringen wie das erste Treffen mit den potenziellen Schwiegereltern-in-spe. Umso mehr in Charlie Kaufmans Film I’m Thinking of Ending Things, den es seit dem 4. September auf Netflix zu sehen gibt: Wir begleiten ein junges Paar, Jake und Lucy, auf dem Weg zu Jakes Eltern, wobei uns Lucys voice-over in die Ausgangssituation einführt. Doch diese ändert sich sogleich auch schon wieder und soll es bis zum Ende des Films stetig tun. Denn ist Lucy im einen Moment noch ganz hin und weg von Jake (»We have a real connection. I’ve never experienced anything like it.«), ist sie im nächsten gedanklich schon dabei, Schluss zu machen (»I’m thinking of ending things.«) und schon heißt sie auch nicht mehr Lucy, sondern Lucia, dann wiederum Louisa.
Die Doppeldeutigkeit des Titels weckt schon vor dem Schauen unangenehme Assoziationen: Denn im englischen »ending things« schwingt eben nicht nur die Bedeutungsebene der Trennung mit, sondern auch die des Suizids. Und recht schnell wird deutlich, dass es hier nur sehr vordergründig um die Geschichte eines Paars geht. Doch worum geht es hier überhaupt? Es geht – und der Film verlangt geradezu, dass man sogleich mit den größtmöglichen Kategorien ansetzt – um das Leben und den Tod. Wir befinden uns an Orten, in denen sich Zeitschichten des Lebens ablagern und geradezu museal konserviert werden: das Elternhaus, die Schule. Und vielleicht geht es besonders um den letzten Abschnitt, das Alter, und den Gedanken an die eigene Sterblichkeit. Wir treffen Jakes Eltern erst als fidele Sechziger, dann altern sie zusehends, werden immer verwirrter, schließlich ist mal eine junge, dynamische Mutter neben einem dementen Vater, dann ein fescher Vater neben einer bettlägerigen Mutter zu sehen. So lässt sich der Film als Experimentierraum verstehen, in dem jener Erfahrung nachgefühlt wird, wie es ist, wenn einem als alternder Mensch die Welt zunehmend entgleitet, ihre Zeichen rätselhaft werden, bis nichts mehr zusammenpasst. Das ist durchaus kritisch angelegt; für eine Weile erklärt die Protagonistin, sie sei Gerontologin, und hält ein Plädoyer für eine bessere gesellschaftliche Behandlung von älteren Menschen. Das könnte interessant sein und relevante Diskussionen anstoßen, die bisher noch zu wenig geführt werden, würde sich der Film darauf konzentrieren, doch stattdessen verliert er sich in seinen eigenen thematischen und formalen Irrungen und Wirrungen.
Is this the real life? Is this just fantasy?Den Drehbuchautor und Regisseur Charlie Kaufman kennt man bereits von anderen Filmen, die man auch nicht verstanden hat: Being John Malkovich zum Beispiel, Adaptation oder Synecdoche, New York. Diese waren immer auch Filme über Filme, über die dünne Grenze zwischen Realität und Fiktion – und das ist auch I’m Thinking of Ending Things. Alles wird ein bisschen deutlicher, und zugleich noch verwirrender, wenn man weiß, dass der Film auf dem gleichnamigen Buch von Iain Reid aus dem Jahr 2016 basiert. Darin entpuppt sich die namenlose Erzählerin als Produkt von Jakes Fantasie, als eine fiktionale Figur, von ihm ins Leben gerufen, um der eigenen Einsamkeit zu begegnen. Sicherlich, so lässt sich der Film lesen: als Tagtraum, der immer wieder neu ansetzt, sich verhaspelt und andere Varianten sucht, sobald die Kommunikation mit den Eltern zu unangenehm wird. Würde es besser laufen, wenn die Fantasiefreundin angehende Ärztin wäre, nein Malerin, nein Quantenphysikerin?
Aber auch so lässt sich keine eindeutige Auslegung finden, denn zu viel bleibt ungereimt: Warum sollte eine von Jake erfundene Figur gleich zweimal erzählen, dass sie am Abend, als sie sich kennen lernten, eigentlich mit ihrer Freundin unterwegs war, um ihren Jahrestag zu feiern? Oder warum bekommt die Protagonistin, als sie noch Lucy heißt, immer wieder Anrufe von einer Lucy, die sie unter einem Vorwand wegdrückt? Und wenn zum Schluss, ohne Details zu verraten, die ganz große Selbstreferenzialitäts-Pauke ausgepackt wird, dann will der Film einfach zu viel: zu viel Verwirrung, zu viel Meta-Meta-Meta, zu viel Trara und zu wenig Substanz. Teile der Geschichte lassen sich enträtseln, recht eindeutig weiß man gegen Ende, was es mit der unscheinbaren Eisverkäuferin auf sich hat und was mit dem traurigen Hausmeister.
 © Netflix
© NetflixDoch der Großteil erscheint einfach als Spielerei, die Horrorfilm-Topoi (Autofahrt im Dunkeln während eines Schneesturms; geheimnisvoller Keller, der nicht betreten werden darf, inklusive Kratzspuren an der Tür; unter mysteriösen Umständen umgekommene Tiere; eine verlassene High School) ins Leere laufen lässt. Auch die konventionelle Perspektivierung des Horrorfilms wird dabei unterlaufen. Die Bezeichnung »Protagonistin« ist für die weibliche Hauptfigur eigentlich nicht ganz richtig, denn schnell merken wir als Zuschauer*innen, dass wir die Geschichte nur scheinbar mit ihr erleben und auch ihr nicht trauen können. Wir sind allein in dieser seltsamen, sich stetig ändernden Erzählwelt. Das erzeugt nicht uninteressante Rezeptionseffekte, der Film ist anstrengend zu schauen, da er ständige Anspannung produziert, ohne diese je zu entladen. Als sähe man mehr als zwei Stunden jemandem zu, der einen Luftballon zu fest drückt, nur damit dieser schließlich doch nicht platzt, sondern die Luft langsam und zischend aus der Öffnung entweicht. Auch psychologisch bleibt der Horror leer, denn um wirklich angsteinflößend zu wirken und Fragen nach existenzieller Verunsicherung zu stellen, ist er zu überkandidelt, kreist er zu sehr um sich selbst.
Metafiktion am LimitSo wirkt I’m Thinking of Ending Things ein wenig aus der Zeit gefallen, erinnert an Filme wie Alain Resnais‘ Letztes Jahr in Marienbad, vielleicht auch an literarische Klassiker der postmodernen Metafiktion wie Mark Z. Danielewskis House of Leaves. Doch ist diese Zeit nicht vorbei – als es möglich war, zum Spaß mit der Negation von Sinn und materieller Wirklichkeit herumzualbern und vorwitzig »Alles ist Fiktion« in die Welt zu krähen? Hat diese Bewegung nicht zurecht ein Ende gefunden, im Angesicht der allzu realen Bedrohungen, die unser Hier und Jetzt prägen?
Die Prämisse des Films (frisch verliebtes Paar auf Elternbesuch) kennen wir schließlich in jüngster Zeit auch aus Get Out, dem grandiosen Horrorfilm von Jordan Peele, in dem nicht nur unterschwellig Rassismus verhandelt wird. Solche Diskurse sind in I’m Thinking of Ending Things auch irgendwie da, immer wieder werden große Themen der Gegenwart – unter anderem Veganismus, Queerfeindlichkeit, Klimawandel – andiskutiert, allerdings führt das nirgendwo so richtig hin. Als Parabel kann und will das dargestellte Wirrwarr der Identitäten nicht herhalten, nicht einmal als eine über die Lebenserfahrung im 21. Jahrhundert selbst, denn dazu bleibt der Film thematisch zu unkonkret und ästhetisch zu altmodisch.
Doch vielleicht muss man das Ganze etwas wohlwollender sehen: Netflix, dessen Film-Eigenproduktionen sich bisher mehr durch Massenkompatibilität als durch Experimentierfreude auszeichneten, wagt mit I’m Thinking of Ending Things einen Schritt in die Arthouse-Richtung. Und Experimente dürfen ja auch mal scheitern, damit beim nächsten die Ergebnisse stimmen.