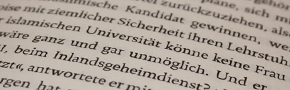Pierre Michon ist ein ›Klassiker‹, der es kurz und heftig mag. Zugleich ist er der vielleicht größte Virtuose des Bandwurmsatzes unserer Zeit. In seinem neuen Kurzroman Die Grande Beune geht er mit Netz und Nylonstrümpfen fischen. Nichts ist schöner, als sich von diesem Meisterwerk monströser Poesie einfangen zu lassen. Michon nämlich kennt das Geheimnis der Vollkommenheit. Es liegt irgendwo zwischen Versuch, Versuchung und einer üppigen Tabakverkäuferin.
Von Nadya Hartmann
»Auch die Teufel, so nehme ich an, beruft man in die Höllenkreise« – Düster beginnt die Erzählung, deren Titel als idyllischer Fluss durch die französische Provinz fließt: Die Grande Beune. Wahrlich schnell rauschen sie dahin, die 94 Seiten Text, die Pierre Michon roman court, »Kurzroman« nennt. Doch Michon, der »bedeutendste lebende Schriftsteller Frankreichs« (arte), der jetzt schon als ›Klassiker‹ gilt, ist keiner, der sich lange mit Banalitäten aufhält. Dantes Höllenkreise sind seinem Wesen verwandt, nicht aber die feinsäuberlich festgelegten Kategorien der Literaturwissenschaften. Bei Michon ist rein gar nichts fein oder sauber. Im Gegenteil. Alles, und das gilt vielleicht insbesondere für Die Grande Beune, ist monströs. Mit wuchtig-kraftvoller Sprache modelliert er seine Figuren wie aus Ton, und auch sie sind von einer derben Eleganz, die Schubladendenkkategorien zum Zerbersten bringt.
Mit Vorliebe lässt Michon in seinen Büchern historische Persönlichkeiten wiederauferstehen: da wären der Poet und Antikonformist Arthur Rimbaud, Maler wie Goya, Watteau oder Van Gogh. In seinem Erstling Leben der kleinen Toten, meisterhaft übersetzt von Anne Weber, schenkte er den »kleinen« Leuten aus seiner Kindheitslandschaft neues Leben. Ihre zuweilen ungewöhnlichen Geschichten umgaben ihn wie die Landluft, den jungen Pierre aus der Provinz. Geboren wurde er 1945 im Limousin, in einer kleinen Ortschaft im départment Creuse. In seiner Jugend spielte er (schlecht, wie er sagt) Gitarre in einer Rockband und begleitete die Bauern zu ihren Feldern. Bis zu seinem 38. Lebensjahr, als die »kleinen Toten« erstmals über Pariser Ladentische wanderten, ging er keinem bürgerlichen Beruf nach.
Michon zitiert viel, manchmal Lebende, meistens aber sind es Tote. Faulkner, dessen »monströse Kraft« er verehrt, habe oft gesagt: »I’m a farmer«. Kurz und knapp, wie Michon es mag: »Il faut que ce soit violent et bref« (»Es muss heftig und kurz sein«), lautet seine schriftstellerische Maxime. Vielleicht vor allem heftig. Seine Vies minuscules (Originaltitel) waren ein Bändigungsversuch seiner Ursprünge: »Ich schrieb es, um meine Wurzeln zu glorifizieren und zugleich, um sie zu verbrennen.« Wie ein Bauer sein Land liebe und hasse er die Landschaft seiner Kindheit. Eine »Trauer der Ländlichkeit« (»deuil de ruralité«) verbindet ihn mit vielen seiner Figuren. In Die Grande Beune vermischt sich diese Trauer mit dem scharfen Geruch von Schweiß und der erdigen Süße frischgeschabter Rüben. In der fantastisch-schaurigen Nebelwelt Michons poetischer Erinnerungslandschaft fühlt sich der Leser wie zu Gast bei Van Goghs »Kartoffelessern«. Ein Unterschied: Es gibt Fisch.
Eine Welt hinter dem RegenEs ist 1961, als der zwanzigjährige Erzähler und Grundschullehrer in die »Hölle« versetzt wird. Er wird verschluckt von einer Welt aus »schwarzem Regen« und Nebelgrau, Nebel »als Hülle für Menschen«. Wie Aquarellfarben laufen Realität und Wahn, Vergangenheit und Gegenwart ineinander. Eine irreale Welt hinter dem Regen, »Regen, der die Welt bloß bedeckt, um anstatt ihrer unsere Träume zum Vorschein kommen zu lassen«. Castelnau heißt der verwunschene Ort, der an der Grande Beune liegt. »Schmutziges Wasser unter schmutzigem Himmel« – Es ist weniger trostlos als unheimlich, unheimlich wie in Freuds Träumen. Im Klassenraum steht eine Vitrine mit prähistorischen Fundstücken, wie es sie in dieser Gegend häufig gibt: Die Höhle von Lascaux ist ganz in der Nähe und mit ihr die Herden der Manganoxid-Stiere und knubbelige Venusfigurinen, die das Geheimnis des Ewig-Weiblichen wahren. Es ist eine feuchte und archaische Welt. Die Erzählung sollte eigentlich »Der Ursprung der Welt« heißen, in Anlehnung an das Skandalgemälde von Gustave Courbet, das eine überlebensgroße Vagina zeigt.
Doch die archaische Sinnlichkeit braucht keinen Titel. Auch ohne ihn taucht Michon unsere Gedanken in Ochsenblutrot – wie die Wände des Gasthauses, in das der Erzähler zu Beginn einkehrt. Das Chez Hélène ist Kern des dörflichen Universums, tagtäglich tauschen die Fischer hier die Gischt gegen schäumende Biere ein. Es ist ein Ort, an dem Männer entweder Jean oder Jeanjean heißen. Hinter dem Tresen steht immer lächelnd Hélène, eine der zwei Frauenfiguren, die wie Lichtgestalten durch den grauen Nebelvorhang brechen. Von üppiger Anmut wie Michons Prosa, navigiert sie ihren dicken Arm über die schmierigen Tische. Die Routine erinnert an den bäuerlichen Alltag Michons Kindheit und den Wechsel der Jahreszeiten. In dieser hermetisch abgeriegelten Lokalität fällt die Zeit zu Ewigkeit zusammen, über Allem thront ein ausgestopfter Fuchs. Hier sitzt der Erzähler vor einer »Schlachtplatte uralter Zeiten«, die Hélène serviert, in der Nase den Geruch von Mauersalpeter. Die Fischer tragen »zeitlose Bärte« und schwarzglänzendes Ölzeug. »Diese Männer waren jung; ihre Müdigkeit, ihre Jagden waren so alt wie die Fabliaux.«
Die Venus der MarlboroschachtelnDas verwaschene Dunkel wie aus Goyas Farbkasten klart auf, als der »Ursprung der Welt« in Gestalt der prallen Tabakverkäuferin erscheint. Und siehe da: »ganz schwarze Wolken verbeugten sich wie Mägde«, es klingt nun wie ein zeitgenössischer Popsong: »Honey, wenn die Sonne sinkt und die Nacht kommt, wenn der Frauen Seele nackt ist wie die Hand. Wagte ich den Gedanken, sie könnte mir gehören?« Natürlich wagt er – den Gedanken, auf den weniger Taten als erotische Fantasien folgen. Er hofft auf ein Wunder und ist sich gleichzeitig der Vergeblichkeit bewusst. Das ›Trotzdem‹ angesichts der Unmöglichkeit ist die heimliche Hauptfigur Michons poetischer Welt, thront über ihr, listig wie der Fuchs und schön wie die Venus der Marlboroschachteln. Hier liegt des Ogers Kern, hier entspringt der Quell der Vollkommenheit.
Vollkommen sind auch die Verse Rimbauds, da sie »von der Unmöglichkeit Kenntnis nehmen […] aber auf dieser Unmöglichkeit aufbauen und, hoch aufgerichtet, auf ihr Trompete spielen.« Immer ist die Literatur der eigentliche Gegenstand seiner Erzählungen, da sie es ist, die die Unmöglichkeit mit Schönheit aufwiegt: »Und doch war sie schön, diese Welt, in der Nylonstrümpfe meinen Geist erfüllten«, stellt der Erzähler fest. Michon, berief sich einmal auf Bataille. Dieser sagte sinngemäß: »Zweifelsohne kann ein Kunstwerk unabhängig von einem Wunder existieren. Doch solange in ihm nicht der Wunsch nach einem Wunder spürbar ist, so ist es kein bedeutendes Werk.« Michons Werk ist ein bedeutendes Werk, Die Grande Beune ist ein wunderbarer Oger.