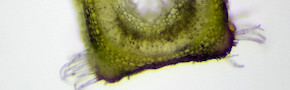Teju Coles Erzähler wandelt zwischen zwei Welten: Nigeria, die Heimat, in der er heimatlos ist, und den USA, wo er ein Fremder ist. Dazwischen: eine Welt voller Gedanken. Valentina Prljic schreibt über diese Gratwanderung, die der Autor, Mediziner und Kunstkritiker in seinem Romandebüt Jeder Tag gehört dem Dieb verhandelt.
Von Valentina Prljic
»Jeder Tag gehört dem Dieb, doch ein Tag gehört dem Besitzer«, ist ein afrikanisches Sprichwort des Stammes der Yoruba. Der nigerianisch-amerikanische Autor Teju Cole hat es seinem gleichnamigen Buch Jeder Tag gehört dem Dieb vorangestellt und eröffnet damit den Grundkonflikt seines Romans: Der Erzähler ist in der Hauptstadt Nigerias, Lagos, geboren, hat das Land aber verlassen, um in den USA Medizin zu studieren. Was hat er verloren, als er die Heimat verließ? Und was hat er gewonnen?
Buch

Teju Cole
Jeder Tag gehört dem Dieb
Ins Deutsche übertragen von Christine Richter-Nilsson
Hanser, Berlin, 2014
176 Seiten, 18,90€
E-Book 14,99€
Der Beginn des Romans verortet den Erzähler zwar geographisch in New York, beschrieben wird davon jedoch ironischerweise nur das unerträgliche Warten in dem nigerianischen Konsulat. Gegen ein Schmiergeld wird dem Erzähler seine Reise endlich ermöglicht, während der Verlauf des Buchs zeigt, dass er zumindest im Kopf die ganze Zeit in Nigeria war. Noch in den USA ist Lagos das Ziel seiner Reise, dort angekommen wird es zum Ort des Geschehens und mit dem Ende des Buchs entwickelt sich die Hauptstadt zum Abschiedspunkt. Lagos ist der rote Faden, der sich durch die Kapitel zieht, die auch Kurzgeschichten sein könnten. Diese Stadt ist nicht nur Teil einer Topographie, sie ist gleichzeitig, wie erst schrittweise deutlich wird, auch der ganze Schmerz des Erzählers.
Lagos wird strenggenommen nicht erst mit dem Ende der Reise zum Ort des Abschieds und der Trennung, sondern ist es die ganze Zeit schon. Jede Erlebnisbeschreibung des Erzählers in der Heimat ist geprägt von der Tatsache, dass er sie bereits einmal verlassen hat. Mit der Rückkehr ist nichts mehr wie es war. Der Lieblingsbuchladen ist verstaubt, die Hitze unerträglich, das Land korrupt und den Menschen alles egal. Die sehr deskriptive Schreibweise wird immer wieder durchzogen von Reflexionen und Erinnerungen des Erzählers, die nicht mehr mit der Gegenwart übereinstimmen. Und sie stellen damit die Frage: hat sich Nigeria verändert oder er selbst?
Eine Antwort, die sich beim Lesen aufdrängt, ist, dass der Erzähler weder ein anderer geworden, noch derselbe geblieben ist. In New York ist der Erzähler ein Ausländer, in Nigeria wiederum gilt er als US-Amerikaner. Es ist egal, wo er ist, sein Bestimmungsort ist kafkascher Art:
›Weg-von-hier‹ – das ist mein Ziel.
Bei seiner Ankunft mit dem Flugzeug ergreift ihn dennoch die Ekstase, »dass jetzt alles gut wird«. Zwischendurch ist er gar der Meinung, nach Lagos zurückziehen zu müssen, empfindet die Stadt gleichzeitig als Vorhölle und reist abschließend völlig überraschend ab. Der Erzähler möchte nicht gehen, aber er weiß auch, dass er nicht bleiben kann.
Vertraute FremdeSeine Zeit in Lagos, die wie in einer persönlichen Reportage wiedergegeben wird, ist unbestimmbar lang. Die Reise ist kein Urlaub, sie ist, wie Teju Cole in einem Interview sagte, wie sein Werk, voller unendlicher Melancholie. Zu dieser trägt bei, dass der Erzähler kaum spricht, sondern hauptsächlich schweigt. Seine Gedanken sind die eines offenbar die Literatur liebenden angehenden Arztes, der sich nicht etwa für die medizinische Infrastruktur des Landes interessiert, sondern dafür, zu welchen Geschichten Nigeria anregt. Lagos ist für den Erzähler die Stadt der Scheherazaden aus Tausendundeine Nacht: »Diese fremde, vertraute Stadt ist durchwebt von Erzählungen«. Während eine Situation, die er erlebt, ihn an Hundert Jahre Einsamkeit erinnert, scheinen ihm beliebige Gegenstände Requisiten aus einem Tschechow-Drama sein zu können. Von einem Gedicht Tomas Tranströmers wünscht er sich, es würde sich auf Nigeria beziehen und sogar des Knaben Wunderhorn ist ihm gegenwärtig. Der Erzähler ist ein Literat, der weiß, dass es ihm nichts nützt. Oder in Worten W.H. Audens, den er verehrt:
Poetry makes nothing happen.
Dass der Erzähler und Protagonist in New York lebt, im Krankenhaus arbeitet und belesen ist, sind Informationen, die während seines Aufenthalts in Nigeria deutlich machen, auf welche Weise er sich von den Menschen dort unterscheidet. Er ist voller Zorn, ob der Lethargie und der Korruption in dem Land und vor allem ob ihrer mangelnden Hochkultur. Er sucht Menschen, die in Nigeria sind wie er in den USA: kosmopolitisch. Als er in einem Bus eine Frau entdeckt, die Ondaatje liest, entwickelt sich diese für die Handlung irrelevante Stelle zum Höhepunkt des Buches. Als sie ihm in der Menschenmenge entwischt, bleibt ihm nur noch der Zorn auf jene, die ihm unähnlicher nicht sein könnten: auf Kriminelle, Gefährliche und Korrupte. Auf jene, die einen Jungen wegen Diebstahls in Selbstjustiz tagsüber auf der Straße verbrennen, auf naive Pastoren, schlafendes Sicherheitspersonal und Nigerianer, die zwar ins Museum gehen, »wenn auch nur für eine Party am Wochenende«.
Die von dem Erzähler viel kritisierte Lethargie der Stadt, greift auf das Buch über. Es selbst beruht nicht unbedingt auf Spannung, sondern vielmehr auf Schwermut. Diese Atmosphäre ist aber keine Schwäche des kurzen Romans, sondern seine Eigenart. Warum reist der Erzähler plötzlich wieder ab? Warum ist er überhaupt nach Lagos zurückgekehrt? Das sind Fragen, um die es in diesem Buch scheinbar nicht geht. So wie der Reisende verschlossen anderen gegenüber ist, verschließt sich das Buch der Leserin. Jeder Tag gehört dem Dieb erzählt nicht von der Geschichte einer Person, sondern von seiner ihn immer begleitenden Distanz, die einerseits beklagt und anderseits umgesetzt wird. Denn laut des Autors bedeutet Fremdsein eines: Wenn man geht, hinterlässt man keine Lücke.