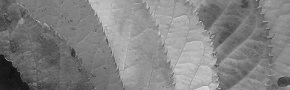Aus dem Literaturjournalismus hat sich Fritz J. Raddatz vor Kurzem mit großer Geste verabschiedet. Von der Bildfläche ist er deswegen noch lange nicht verschwunden. Im Alten Rathaus gab er Einblicke in seine gesammelten Indiskretionen.
Von Sebastian Böck
Göttingen, am Abend des 23. Oktober. Im holzgetäfelten Saal des Alten Rathauses raunen die Wartenden. Dielen knarzen, ein Handy läutet. Dann erscheint er. Stille. Der Erscheinende: Fritz J. Raddatz. Feuilletonist – Buchautor – Lebenskünstler.
Einen Namen machte sich Raddatz allem voran als Cheflektor des Rowohlt Verlags in den sechziger und legendärer ZEIT-Feuilletonchef in den späten siebziger bis frühen achtziger Jahren. Neben zahllosen literarischen Essays veröffentlichte der heute Dreiundachtzigjährige eine Reihe von einschlägigen Schriftstellerbiographien, unter anderem zu Rilke, Marx, Benn und selbstredend dem großen Vorbild Tucholsky, um dessen Nachlasspflege er sich als Vorsitzender der von ihm mitbegründeten Kurt-Tucholsky-Stiftung verdient machte. Auch erschienen eigene Romane (Eine Erziehung in Deutschland: Trilogie, 2006), Erzählungen (Kuhauge, 1991) sowie ein vielbeachteter Briefwechsel mit Uwe Johnson (»Liebes Fritzchen« – »Lieber Groß-Uwe«, 2006).
Leben als Kunstwerk – der »Roman Raddatz«Raddatz Ruf – man möchte sagen, sein eigentliches Werk – prägte indes nicht so sehr die Literatur als vielmehr deren äußerer Rahmen; also das, was man in diesem Fall berechtigterweise als »Literarisches Leben« bezeichnen kann: Die Intrigen und Eitelkeiten auf dem Parkett des deutschen Nachkriegskulturbetriebes, die Ränke und Affären, die sich beispielhaft um das Skandalon von Raddatz Absetzung als Ressortleiter der Hamburger Wochenzeitung oder seinen nicht weniger spektakulären Rauswurf bei Rowohlt spannen.
An literaturträchtigen Stoffen lässt es diese Vita, die uns seit Herausgabe des zweiten Bandes der Raddatz’schen Tagebücher (2002 – 2012, 2014) zusammen mit seinem Vorgänger (1982 – 2001, 2010) und den Memoiren (Unruhestifter, 2003) nunmehr als Werktrias, als »großes autobiographisches Projekt« ihres unbescheidenen Protagonisten vorliegt, nicht missen. Ebenso wenig an Charakteren. Denn das Register derer, die eine Nebenrolle in Raddatz Leben zu spielen hatten, ist lang. Es reicht von intimen Freundschaften zu einigen der bedeutendsten Autoren seiner Generation (Cioran, Kempowski, Enzensberger, …) über erbitterte Feindschaften – nicht wenigen an der Zahl –, welche der Streitbare mit besonderer Vorliebe in Kritiker- und Verleger-Kreisen kultivierte (Dönhoff, Karasek, Reich-Ranicki, …), bis hin zu den schillernden Grautönen des Dazwischenliegenden, jenen »Hasslieben«, die ihn mit einem Günter Grass oder Rudolf Augstein verbanden.
Frank Schirrmacher sah in den Aufzeichnungen seines Kollegen, in denen er selbst übrigens wenig schmeichelhaft als »unwahrer Mensch« oder »Beelzebub« figuriert, gar den »große[n] Gesellschaftsroman der Bundesrepublik« verwirklicht, ein Panoptikum der deutschen Literaturszene am Ausgang des 20. Jahrhunderts. Rainald Goetz attestierte: »Den Roman Raddatz liest man im Rausch, Hunderte Seiten in ein paar Tagen, so gierig, wie Raddatz gelebt hat.«
Spiegelschau und ReflexionIm Lichtschein der tief hängenden Kronleuchter hat Raddatz mittlerweile Platz genommen. Die Kulisse stimmt. Die Inszenierung – um deren Feinheiten der Arbiter Elegantiarum seit jeher weiß – fügt sich ins Bild. Keine zwei Meter daneben hält Stephan Lohr, der Moderator des Abends, eine kleine Laudatio. In seiner ausgewaschenen Jeans und dem unförmigen schwarzen Jackett wirkt Lohr geradezu als Kontrastfolie zu dem geputzten älteren Herren im Tweedsakko, dessen Stilsicherheit, aber auch Hang zur Selbststilisierung er soeben in Worte zu kleiden versucht und der seinerseits einige musternde Blicke in das – mehrheitlich regenbejackte – Publikum wirft.
Stil, das bedeutet für FJR, wie er sich selbst gerne etikettiert, insbesondere Ausdruck. Sprachlich wie habituell. Das Gespräch mit Lohr, das sich mit den Lesungsepisoden des Abends abwechselt, bestimmt von Beginn an ein kulturpessimistischer Tenor. Immer wieder kreist es um den elitären Anspruch eines Ästheten an eine ihn unbefriedigende Umwelt. Es ist eine Welt, die eine andere geworden sei als jene, die er ein- und durch das Ventil seiner Tagebücher gleichsam »ausgeatmet« habe; eine Welt, deren Feinheiten sich mit den Jahren immer mehr abgeschliffen zu haben scheinen und der er sich – seinen Rückzug aus dem journalistischen Tagesgeschäft folgernd – abhanden gekommen fühle. Sprache, Sitten, Journalismus, Literatur: Alles verfällt. Seine gegenwärtigen Überreste taugen nur mehr zum Schatten eines in der Rückschau erstrahlenden Gestern.
Eben dieses subjektive Gestern ist es, das der Autor in seinen Erinnerungen derart lebendig heraufzubeschwören vermag, dass es seine Leser bzw. Zuhörer über die vielen, sich ständig wiederholenden Larmoyanzen mehr als hinwegtröstet. Der Blick durch das Schlüsselloch hinein in die Arbeitszimmer und Salons der gehobenen Hamburger Bohème bereitet einem ein ungeheures voyeuristisches Vergnügen. Die Sottisen sitzen, die Anekdoten aus dem innersten Kreis der Literaturszene begeistern. Zur Hochform gelangt der Gesellschaftsdiagnostiker immer dann, wenn er zum filigranen Sezierbesteck greift, um damit detailverliebt in Nebensächlichkeiten zu stochern. In geschmackvollen Tapetenmustern, geschmacklosen Gartenmöbeln, englischen Maßhemden, dem obligatorischen, aber mittlerweile verabschiedeten Distinktions-Porsche, seiner per Erste-Klasse-Ticket auf dem Nachbarsitz eingeflogenen Tiffany-Lampe, den eigentlich auf jede Tafel gehörenden und dennoch chronisch vakanten Messerbänkchen etc. pp. – die Oberflächen der Dinge reflektieren nun einmal immer auch die Menschen, die sich mit ihnen umgeben. Das Nebensächliche wird so zum Eigentlichen, die geleerten Champagnerflaschen zum entlarvenden Spiegel eines Milieus, hinter dessen Idealen sich nicht zuletzt materielle Werte und profane Befindlichkeiten maskieren. Diese legt Raddatz offen, nahezu beiläufig, im Reflexionsmodus des Tratsches. Darin liegt, trotz oder gerade aufgrund der naturgemäß einseitigen Ich-Perspektive des Tagebuches, sein subversives Potenzial.
Nackt auf dem MarktplatzDass der Autor jenen »Dorian-Gray-Spiegel«, den er seinen Kollegen über hunderte Buchseiten hinweg vorhält, immer wieder auch gegen sich selbst richtet, markiert eine andere Facette dieser Tage-, nein »Nachtbücher«, wie Raddatz sie mit Verweis auf ihre tagesbeschließende Funktion zu nennen pflegt. Nachtstückhaft sind sie schon deswegen, weil sie den Finsternissen ihres Verfassers nachspüren, seinen dunkelsten Stunden, in denen der leiernde Klagegesang über oft allzu weltliche Kränkungen und Frotzeleien plötzlich an ganz und gar existenzielle Wunden rührt. Auch sie legt Raddatz offen, auch in diesen Passagen ist er schonungslos. Von den Schatten einer vergangenen, jedoch nie überwundenen Kindheit zwischen Bombennächten und stiefväterlichem Missbrauch schreibt er ebenso unverhohlen wie über seine ausschweifende Sexualität, die eigene Hypochondrie, die hinter jedem Schnupfen bereits einen »Nasenkrebs« wittert, oder die sich zusehends lichtenden Reihen von Weggefährten.
»Warum stellst du dich nackt auf den Marktplatz, deiner Scham entblößt?«, befragt Raddatz sich gegen Ende der Lesung selbst. »[…] ein jeglicher Autobiograph tat das, es ist das Wesen des Genres«, antwortet ihm das Papier.