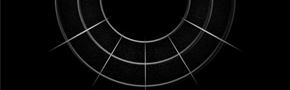Edward Snowden ist seit der von ihm angestoßenen Debatte über die flächendeckende Überwachung eine nahezu omnipräsente Person. Citizenfour schafft es dennoch, eine weitere, neue Facette zu Snowden und der Überwachungsaffäre hinzuzufügen.
Von Florian Pahlke
Eigentlich ist Citizenfour schon längst wieder passé und gerade das macht ihn zu einem hoch aktuellen Film. In Zeiten von Pegida, einer allgemeinen Terrorangst und der Ukraine-Krise, in Zeiten also, in der Ausfälle wie jüngst von Jazenjuk im Interview mit der ARD gänzlich untergehen oder selbst Berichte über Foltermethoden der CIA in ihrer Resonanz eine erschreckend geringe Halbwertszeit aufweisen, mutet die Verfilmung der von Edward Snowden aufgedeckten Überwachungsaffäre wie ein merkwürdiger Anachronismus an. Überhaupt wartet der Film, der seit Oktober in den europäischen Kinos gezeigt wird und den Titel des Pseudonyms trägt, welches Snowden als Whistleblower verwendete, mit einer ganzen Reihe an Ambivalenzen auf.
Der Film
Der Dokumentarfilm Citizenfour portraitiert die Tage der Enthüllung des Überwachungsskandals aus der Perspektive Edward Snowdens, des Journalisten Glen Greenwald und der Produzentin Laura Poitras. Der Film zeigt überwiegend Originalaufnahmen aus dem Hotelzimmer in Hongkong, in dem Snowden sich zu der Zeit eingemietet hatte.
Er gewann u. a. einen Oscar 2015 in der Kategorie Beste Dokumentation und wurde mit dem British Academy of Film and Television Arts Award für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.
Der Film kann aufgrund dieser Konstellation nicht einfach nur berichten, sondern steht immer schon unter dem Verdacht der persönlichen Auslegung. Da ist zum anderen aber auch die offenkundige Schwierigkeit mit der Person Snowden selbst, der »not the story here« sein möchte und dem Film doch unweigerlich seinen Stempel aufdrückt. Auch wenn das wiederum ebenfalls in der Natur des Filmes liegt, zeigt sich die Schwierigkeit umso stärker, weil der Film unstreitig dadurch gewinnt, dass die Überwachungsaffäre hier zumindest auf der einen Seite der Debatte ein Gesicht erhält, das glaubhaft für die zu verteidigenden Werte an sich steht.
 Edward Snowden & Glenn Greenwald in Hongkong.
Edward Snowden & Glenn Greenwald in Hongkong.
Wenn Snowden beteuert, sich seiner Lage bewusst zu sein und diese sowie zukünftige Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, weil er nur so für freie und private Gedanken einstehen könne, wirkt das äußerst glaubhaft. Gerade diese Überzeugung, mit der er agiert, verleiht ihm jedoch eine Präsenz, die an einigen Stellen dazu führt, die Überwachungsproblematik auf ein privates Schicksal herunterzubrechen. Stellvertretend dafür zeigt sich dabei insbesondere das Filmende, welches nicht nur aufzeigt, dass es mindestens einen weiteren Whistleblower gibt, der Snowdens Vorbild zu folgen scheint. Kurz zuvor werden Snowden und seine Freundin, die ihm nach Russland gefolgt ist, eingeblendet; und diese Szene in ihrer fast gespenstisch anmutende Idylle gewinnt über Snowdens Status als politischer Asylant hinaus dann doch noch eine gewaltige und allgemeine Symbolkraft dafür, dass es für den Einzelnen trotz allem irgendwie weitergehen muss und kann.
Eng verbunden damit ist die Schwierigkeit, die sich in der Wechselwirkung zwischen der Entstehung des Filmes und seiner Ausstrahlung offenbart. Der Inhalt, der die Welt am 3. Juni 2013 erschüttern konnte, ist heute längst nichts Neues mehr. So ist es auch weniger die Enthüllungen über das Ausmaß der Überwachung, die für Spannung sorgen kann, sondern es sind vor allem die Alltags-Details, die den Film so sehenswert machen. Wenn Snowden das Telefon vom Netz trennt oder sich ein Tuch beim Eingeben eines Passwortes über den Kopf zieht, um eine Überwachung zu verhindern, und das alles mit der größten Selbstverständlichkeit dem sichtlich skeptischen Journalisten Glen Greenwald erläutert, dann zeigt sich vor allem der Beginn einer Entwicklung, die rasant Richtung Paranoia steuert, der sich die Protagonisten ebenso wenig wie die Zuschauer entziehen können.
 GCHQ Satelliten in Bude, England.
GCHQ Satelliten in Bude, England.
Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass dieses Bewusstsein der ständigen Überwachung im heutigen Alltag mittlerweile kaum noch Schlagkraft entwickeln kann, weil es grundsätzlich bekannt ist. Seine stärksten Momente knüpft der Film daher vor allem an die Personen, an Snowden, dem jegliche Larmoyanz fremd zu sein scheint, an Greenwald, der selbst überaus komplexe Themen schnell erfassen und nahezu druckreif wiedergeben kann und nicht zuletzt auch an die kurzen Einspielungen von Medienbeiträgen, die das Geschehen im Juni 2013 sowie die Entwicklung davor jeweils kurz zusammenfassen und vor allem als Stimmungsbarometer dienen.
Das Problem, welches auch der Film nicht lösen kann, liegt gerade darin, dass, genauso wie Snowden nur Teil der Internet-Hydra ist, die sich gegen die NSA stellt und dabei von der breiten Masse abgekapselt zu sein scheint, auch die alles regierenden und überwachenden Organe in dieser Parallelwelt verortet zu sein scheinen, vor der längst kapituliert wurde. Der Film zeigt gerade damit eine erschreckende Realität auf, die selbst jetzt, knappe zwei Jahre später, wie eine grausige Zukunftsvision daherkommt. So mutet es fast zynisch an, dass am Ende des Filmes der gesamte Saal zu klatschen beginnt, nur um wenig später gedankenverloren die verpassten Nachrichten auf dem Handy zu kontrollieren. Und doch zeigt gerade das vielleicht am eindrücklichsten auf, was der Snowden-Film zu berichten weiß: Es braucht immer wieder Einzelne aus dieser Masse, die sich trotz der ausweglosen Situation ihrer Mittel und Wege bewusst werden, um eben nicht stets wieder in den Alltag zurückzukehren.