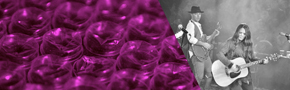Selbstfindung setzt voraus, sich verloren zu haben: In Benedict Wells‘ klugem Bestseller Vom Ende der Einsamkeit lassen Trauer und Schicksalsschläge den Protagonisten die Frage nach dem eigenen Ich verhandeln.
Von Tessa Isabell Brinkhaus
Wie werde ich zu dem, der ich bin?Sind es Erfahrungen, die uns prägen? Sind es Veranlagungen, die uns individuell gegeben sind? Oder sind wir einfach SklavInnen unserer Gene? Was machen unsere Erinnerungen mit uns, unsere Kindheit, unsere Jugend? Besitzen wir Charaktereigenschaften, die uns wie ein Fünkchen Schicksal in die Wiege gelegt sind und die unsere Persönlichkeit ausmachen, egal was wir erleben? Und wenn es eine Mischung aus allem ist, was überwiegt am Ende?
Wir alle kennen diese Fragen. Während wir vor einigen hundert Jahren noch in gesellschaftliche Stände, Berufsgruppen und Geschlechterrollen eingeteilt wurden und bequem sagen konnten: »So soll es sein, so kann es bleiben«, gilt Identität in vielen der heutigen Gesellschaften keineswegs mehr als etwas Stabiles oder einfach Gegebenes. Stattdessen sind wir am Zug. Besonders schlaue Köpfe weisen darauf hin, dass Identität ein relationaler Begriff ist – das heißt, es braucht etwas, womit etwas identisch sein kann. Jeden Tag aufs Neue müssen wir also Bilder vom Ich entwerfen, bewerten, uns in unseren vielfachen sozialen Rollen verorten, mit alten Aufnahmen abgleichen und miteinander versöhnen, um letztlich sagen zu können: Das macht mich aus. #
Das ist eine richtige Leistung. Und da unsere soziale Umgebung gern als »Leistungsgesellschaft« deklariert wird, muss dieses Potenzial auch gleich abrufbar sein. Schon die einfache Bewerbung auf einen Nebenjob wird zum Selbstfindungsprozess. Abhilfe wird überall angepriesen: von HobbypsychologInnen über Hypnosesitzungen bis hin zur altbewährten Ratgeberliteratur. Dabei wies der Philosoph David Hume schon im 18. Jahrhundert darauf hin, dass Identität nur eine Illusion sei; ein verzweifelter Versuch, der Fülle von subjektiven Wahrnehmungen eine Substanz zu verleihen.1 KünstlerInnen und LiteratInnen der Moderne und Postmoderne haben sich alle Mühe gegeben, vermeintliche Realitäten zu dekonstruieren, um zu zeigen, dass es keine objektive Identität gibt. Wozu also das Ganze, könnte man fragen.
Als mögliche Antwort kann Benedict Wells‘ aktueller Roman Vom Ende der Einsamkeit gesehen werden, bereits der zweite Bestseller des Autors, dessen Debüt-Roman Becks letzter Sommer 2015 verfilmt wurde. Auch wenn ›Selbstfindungsroman‹ als Etikett nicht ausreicht, um den Text zu beschreiben, der sowohl Familiendrama als auch Entwicklungsroman und Liebesgeschichte ist, spielt Identität in ihm eine zentrale Rolle. Denn er schildert, wie sich der Protagonist Jules den eingangs aufgeworfenen Fragen stellt, da er seit dem Tod seiner Eltern das Gefühl hat ein Leben zu leben, das nicht zu ihm gehört. Das macht er so klug, berührend und erfolgreich, dass sich ein genauerer Blick lohnt.
Jules ist um die vierzig, kommt nach einem beinah tödlichen Motorradunfall in einem Krankenhauszimmer zu Bewusstsein und fragt sich, warum ihn sein Leben dorthin geführt hat. Ausgehend davon entführt der Roman die LeserInnen in chronologischer Reihenfolge in verschiedene Etappen von Jules‘ Leben. In unbeschwerten Kindertagen wird Jules uns als mutiger 10-Jähriger vorgestellt, der sich am liebsten Geschichten ausdenkt und niederschreibt. Doch es dauert nicht lange, bis Jules an einem entscheidenden Wendepunkt ankommt, der einen Schnitt zwischen seiner glücklichen Kindheit und dem Darauffolgenden setzt. Er ist gerade elf Jahre alt, als seine Eltern kurz nach Weihnachten in der französischen Heimat seines Vaters mit dem Auto verunglücken. Sie hinterlassen drei Kinder. Jules und seine beiden älteren Geschwister Marty und Liz müssen fortan in einem staatlichen Internat aufwachsen. Trotz der engen Verbindung in Kindertagen, trennen sich ihre Wege dort sehr bald. Während sich der naturwissenschaftlich begeisterte, zielstrebige Marty zu einem Einzelgänger in Schwarz verwandelt, verliert sich die lebenshungrige Liz in Rebellionsversuchen und Männergeschichten. Übrig bleibt der nachdenkliche Jules, der sich in der neuen Umgebung schnell in seine eigene Fantasiewelt zurückzieht. Dort erreicht ihn nur Alva, seine einzige Freundin, die nicht ganz so verträumt wie Jules daherkommt, obwohl sie einmal zugibt, gern selbst eine Romanfigur aus ihren Büchern sein zu wollen. Bei Alva erlebt Jules zum ersten Mal wieder Geborgenheit. Doch in seinem verzweifelten Versuch sie festzuhalten, verliert er auch diesen Menschen nach seiner Schulzeit wieder.
Als junger Erwachsener verläuft Jules‘ Leben so unstetig, wie er sich innerlich fühlt. Städte, Berufe und Menschen wechseln, doch ein Zuhause scheint Jules nirgends zu finden. Obwohl die unähnlichen Geschwister versuchen, sich gegenseitig Halt zu geben, bleibt jeder in seinen eigenen Problemen gefangen. Nach einem abgebrochenen Jurastudium versucht sich Jules eine Weile als Fotograf, denn »Fotos sind präziser, wahrer« als die Geschichten, die er als Kind und Jugendlicher geschrieben hat. Obwohl ihn die alten Kameras immer mit seinem Vater verbunden haben (sie waren Geschenke von ihm), findet er sich auch im Fotografieren nicht wieder. Selbst nachdem er Alva nach vielen Jahren wiederbegegnet und eine Familie gründet, bleibt für ihn und seine Geschwister die Frage »Was wäre, wenn…?« stets präsent. Als Jules nach einer weiteren Katastrophe erkennt, dass Verlust sein ständiger Begleiter bleiben wird, muss er sich entscheiden: Siegt der einst draufgängerische Junge in ihm oder fordert die Angst ihren Tribut?
»Das Selbst muss gebrochen werden, um Selbst zu werden«Es sind Schicksalsschläge, der Tod, aber auch die alltäglichen Krisen, welche die Figuren die Frage nach dem eigenen Ich immer wieder neu verhandeln lassen. Anhand der mehr als unterschiedlichen Geschwister fächert der Text auch drei mögliche Arten auf, mit Verlust umzugehen. Trotz der oft schweren Kost vermeidet es der Roman, sich in Rührseligkeit oder Pessimismus zu verlieren. Sicher kommt einem einiges bekannt vor. Damit sind nicht nur die gut ausgewählten Verweise auf die Literatur- und Musikgeschichte gemeint.
Der ein oder andere Mangel an Originalität, beispielsweise wenn sich die Geschwister mithilfe eines LSD-Trips näherkommen wollen, ist verzeihlich. Ab und zu ein bekanntes Erzählmuster oder Motiv lassen durchaus ein vertrautes Gefühl aufkommen. Zudem gelingt es dem Autor, seinen Figuren im Laufe des Romans ein feinsinnig ausgearbeitetes Eigenleben einzuhauchen. So wird man als LeserIn gern zu ihren KomplizInnen, wenn sie zwischen Kierkegaard- und Rilke-Zitaten versuchen, sich ihrer Angst vor Verlust und damit dem Leben zu stellen.
In einer Gesellschaft, in der von uns ständig nur Antworten darauf erwartet werden, wer wir sind und was wir darstellen wollen, wirft Vom Ende der Einsamkeit lediglich Fragen auf. In unaufgeregter Sprache und ohne konstruierte Situationskomik wirkt das angenehm ehrlich. Aber wozu nun also die Frage nach dem Selbst? Ob die Antwort das ›Ende der Einsamkeit‹ bedeutet oder vielleicht eine Bedingung dafür ist, sich in heutiger Komplexität zurechtzufinden, möge offen bleiben. Welchen Anteil unsere Erfahrungen daran haben, wer wir sind oder sein wollen, muss sich erst entscheiden. Doch Wells‘ Roman entlässt seine LeserInnen mit einem guten Gefühl: Die Entscheidung liegt bei uns.
- Vgl. Stefan Glomb: Art. Identität, persönliche; Identitätstheorien. In: Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. 4. aktualisierte und erweiterte Aufl. Stuttgart u.a. 2008, S. 306-308. ↩